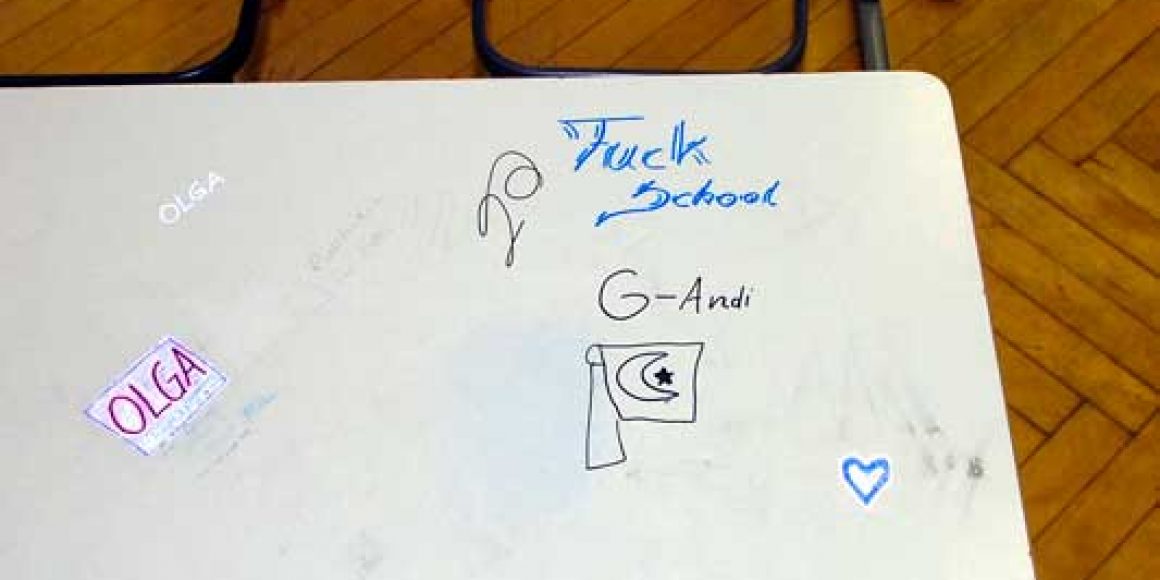Am 13. September veranstaltete das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) Köln gemeinsam mit der Ruhr-Uni Bochum und der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit die Fachtagung »Rassismus und Antisemitismus in der Schule. War da was?«. Mehr als 100 Personen, vor allem aus der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit, nahmen teil.
Die Vorsitzende des ZfL, Myrle Dziak-Mahler, eröffnete die Konferenz mit Berichten von verschiedenen Schulen. Äußerungen wie »Scheiß Jude!« fielen immer häufiger im schulischen Alltag, erklärte sie. Kurz vor der Veranstaltung habe sie mit einer jüdischen Mutter telefoniert, die gerade beschlossen hatte, ihr Kind wegen wiederkehrender antisemitischer Äußerungen von der Schule zu nehmen. Dies sei nicht in Sachsen oder Berlin-Schöneberg geschehen, sondern nicht weit entfernt vom Kölner Tagungsort, betonte Dziak-Mahler.
rassismus Anne Broden von der Kölnischen Gesellschaft ging auf das Spannungsfeld zwischen Rassismus und Antisemitismus ein. Sie hob in ihrer kurzen Einführung vor allem den sekundären Antisemitismus hervor und meinte, viele Deutsche hätten das Bedürfnis, den Hass gegen Juden in der aktuellen Zeit nur noch als ein muslimisches Problem darzustellen.
Saraya Gomis hielt das erste Impulsreferat über Alltagsrassismus und einen Lehrplan, der die Lebenswelten von schwarzen Kindern und Jugendlichen kaum einbezieht. Dass dies auch bei jüdischen Kindern der Fall ist, führte Astrid Messerschmidt aus. Im Unterricht würden Juden meist nur als Opfer der Schoa behandelt. Modernes oder sefardisches Judentum komme gar nicht vor.
Gleichzeitig werde auch das Thema Antisemitismus nur oberflächlich und in Bezug auf die deutsche Vergangenheit besprochen. Weder muslimischer noch sekundärer Antisemitismus fände Einzug in den Lehrplan. Insgesamt gingen Lehrkräfte von einer jüdischen Nichtpräsenz an ihren Schulen aus. Wissen sie von jüdischen Schülern, verkehre es sich in ein absurdes Gegenteil, und Lehrer seien regelrecht stolz darauf, einen Juden zu unterrichten.
Das bestätigte auch der Berliner Lehrer Mehmet Can, der mit der Bonner Lehrerin Michaela Lapp über die realen Zustände an Schulen diskutierte. So sprächen sich einige Lehrer mit Hinweis auf ihr gutes Verhältnis zu ihren muslimischen oder jüdischen Schülern von Rassismus und Antisemitismus frei, erklärte Can.
nahostkonflikt Vor allem in Schulen, in denen hauptsächlich »Herkunftsdeutsche« lernen, betrachte man Antisemitismus meist als Ideologie von Neonazis und Islamisten. Gleichzeitig forderten einige seiner Schüler einen Schlussstrich unter die deutsche Vergangenheit. Offen antisemitische Aussagen kenne er von herkunftsdeutschen Schülern jedoch kaum, sondern nur von Schülern mit einem familiären oder religiösen Bezug zum Nahostkonflikt.
Im zweiten Teil der Tagung fanden verschiedene Workshops statt. Zwei davon stellten die Frage, welche Kompetenzen im Lehrberuf in Bezug auf Antisemitismus und Alltagsrassismus nötig seien. Zwei weitere befassten sich mit dem Thema Schulbücher. Ingolf Seidel machte eindrucksvoll deutlich, welche Mittel angewandt werden, um Israel in Schulbüchern als Aggressor darzustellen.
Die Tagung kann im Hinblick auf das große Interesse und den regen Austausch als Erfolg gewertet werden. Einige Teilnehmer wünschten sich jedoch eine stärkere Thematisierung von muslimischem Antisemitismus, da sie in ihrem Arbeitsalltag immer wieder damit konfrontiert würden.