DORF-POESIE
Meir Shalevs Judiths Liebe kam gleich nach dem ersten Lesen ins Regal mit den Büchern, die im Haus bleiben müssen – weil seine Leichtigkeit in guten Zeiten beflügelt und seine Ernsthaftigkeit in schweren Zeiten eine Schulter ist. Zu Beginn verortet man die Menschen und Geschichten fast im Schtetl, so magisch und so verloren scheint die Welt, in der der kleine Sejde, den seine Mutter Großvater nennt, um den Engel des Todes zu verwirren, aufwächst; wo drei Männer wohnen, die davon überzeugt sind, der Vater des Kindes zu sein; und wo der Autor Mensch und Tier gleichermaßen zum Tanz bittet mit den großen und kleinen Gefühlen des Lebens und dabei niemandem den Vortritt lässt. Weder dem feinsinnigen Jacob, der zwischen leeren Vogelkäfigen lebt, noch Moshe, ein Mann so kräftig wie ein Ochse, der als Erwachsener den Zopf vermisst, den seine Mutter ihm als Kind abgeschnitten hat, und auch nicht der mysteriösen Judith, die weiß, dass man sich seinem Dibbuk stellen muss.
Tatsächlich beginnt die poetisch-fantastisch-bodenständige Geschichte in den 30er-Jahren in einem kleinen Dorf zwischen Galiläa und Samaria, als eine vom Schicksal gepeinigte Frau einem unglücklichen Witwer auf dem kleinen Hof und mit den kleinen Kindern helfen soll. Bescheiden, zupackend, aber auch sturköpfig ist Judith, die immer im Kuhstall schläft, für alles und jeden da, doch ohne je selbst um Hilfe zu bitten oder Schwäche zu zeigen. Auch deshalb soll niemand erfahren, wer denn nun der Vater des Kindes ist, dem die junge Frau ihre ganze Liebe gibt. Aber darauf kommt es am Ende auch gar nicht an. Sophie Albers Ben Chamo
Meir Shalev: »Judiths Liebe«. Übersetzt von Ruth Achlama. Diogenes, Zürich 1999, 400 S., 14 €
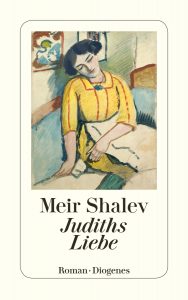
LEBENS-BEGLEITER
Vielleicht ist der schönste Teil von Winterjournal der, in dem Paul Auster die vielen Apartments aufzählt, in denen er in New York gelebt hat. Schäbige, kleine Einzimmerwohnungen, etwas geräumigere, schäbige Zweizimmerwohnungen oder Wohnungen mit schrägen Nachbarn. Später ein Haus im Wald. Vielleicht ist es aber auch der Teil, in dem er seiner Frau, der Schriftstellerin Siri Hustvedt, seine innige Liebe erklärt – sie ist ihm Freundin und Geliebte, sie macht ihn hilflos, und er muss sie nicht stark machen. Vielleicht ist es aber auch der Hauch der Vergänglichkeit, die Abschiede, das Verschwinden, der Tod, die dieses Buch so schmerzvoll lebendig machen, dass man es nicht nur einmal liest, nicht zweimal, nicht von vorn bis hinten, sondern auch mal mittendrin.
Oder es ist einer der schönsten und wahrsten ersten Sätze überhaupt, der im Original so klingt: »You think it will never happen to you, that it cannot happen to you, that you are the only person in the world to whom none of these things will ever happen, and then, one by one, they all begin to happen to you, in the same way they happen to everyone else.« Ganz sicher ist: Das Buch aus dem Jahr 2012 ist ein ständiger Begleiter im Sommer des Lebens – und auch im Winter. Katrin Richter
Paul Auster: »Winterjournal«. Übersetzt von Werner Schmitz. Rowohlt, Hamburg 2015, 256 S., 12 €
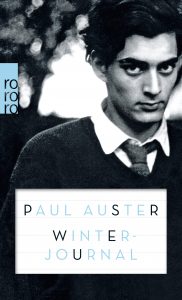
MALLORCA-EXIL
Was wäre für die Urlaubslektüre angemessener als ein Mallorca-Roman? Doch Vorsicht: Es geht hier nicht um einen heiteren Urlaub unter Palmen. 1953 tauchte plötzlich der bis dato völlig unbekannte Schriftsteller Albert Vigoleis Thelen auf und legte mit Die Insel des zweiten Gesichts gleich sein Meisterwerk vor.
Die Handlung ist schnell umrissen: 1931 geht der junge Vigoleis mit seiner Lebensgefährtin Beatrice aus privaten Gründen nach Mallorca und bleibt 1933 aus politischen Gründen dort. Das Leben unter prekären Verhältnissen auf der Balearen-Insel ziehen sie dem in Nazi-Deutschland vor. Hier begegnen sie Anarchisten, verarmten Adligen, Emigranten, Prostituierten, Hochstaplern, Käuzen und Originalen, bis 1936 der Spanische Bürgerkrieg auch auf Mallorca wütet und die beiden nur knapp mit einem britischen Frachter fliehen können.
Doch um die Handlung geht es eigentlich kaum. Es sind die absurd-komischen Szenen, die Porträts und die Schilderung der verwickelten politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, die den Reiz ausmachen. Autobiografisch ist das Ganze zwar, aber erst Jahre später aus dem Gedächtnis niedergeschrieben und durch dieses gefiltert.
Herrlich ist die Schilderung der Touristen aus dem Deutschen Reich, die mit ihren Kraft-durch-Freude-Schiffen gruppenweise auf der Insel einfallen. Offenbar war Mallorca schon in der Nazizeit für deutschen Massentourismus erschlossen. Wie zu erwarten, kommen diese Pauschalreisenden bei Thelen nicht besonders gut weg. Dabei ist die Abneigung des rheinisch-katholischen Atheisten gegen die Nazis und die ihnen bereitwillig folgenden Massen gar nicht aus religiösen oder parteipolitischen Erwägungen gespeist, sondern aus schlichtem menschlichen Anstand und Common Sense.
In einem Rutsch lesen kann man die beinahe 1000 Seiten kaum. Dafür hat man lange etwas davon, und wenn man schließlich am Ende angelangt ist, möchte man am liebsten gleich wieder von vorne anfangen. Ingo Way
Albert Vigoleis Thelen: »Die Insel des zweiten Gesichts. Aus den angewandten Erinnerungen des Vigoleis«. List, Berlin 2005, 944 S., 18 €

KIBBUZ-KOMIK
Sätze wie »Jakob Markowitz war nicht hässlich. Was nicht heißen soll, dass er schön gewesen wäre« oder »›Glücklich?‹ Sonia machte große Augen vor Staunen. ›Seit wann hängen Glück und Liebe zusammen?‹« machen den Roman Eine Nacht, Markowitz zu einem der besondersten Bücher, die jemals aus Israel kamen.
Ayelet Gundar-Goshen erzählt auf 426 Seiten von einem Kibbuz in der Zeit des Unabhängigkeitskrieges, erzählt von seinen Bewohnern, von Jakob Markowitz, der die schöne Bella in einer eigentlich nur zum Schein geschlossenen Ehe festhält, von Sonia Feinberg, die ihren Seev liebt, aber auch den Irgun-Vizechef, von Rachel, die nach der Schoa an schweren Depressionen leidet. Erzählt von Israels Anfangsjahren, in denen seine Bewohner zwischen alten Traumata und neuen irgendwie versuchten zu leben, die Waffe immer im Anschlag.
Sie erzählt die Geschichte eines Landes und seiner besonderen Menschen. Auf eine Art und Weise, wie Geschichten selten erzählt werden. Gundar-Goshens Figuren atmen und springen dabei manchmal förmlich aus den Seiten. Sie schafft es, noch die tragischsten Momente mit Situationskomik zu entwaffnen, und immer wieder geben fast magische Momente dem Buch einen geradezu fantastischen Anstrich. Eine Nacht, Markowitz ist deshalb die perfekte Sommerlektüre, weil es immer die perfekte Lektüre ist. Ein Buch wie das Land, aus dem es stammt: komisch, tragisch und unendlich fesselnd. Katharina Höftmann-Ciobotaru
Ayelet Gundar-Goshen: »Eine Nacht, Markowitz«. Übersetzt von Ruth Achlama. Kein und Aber, Zürich 2013, 432 S., 22,90 €

LIEBES-ERINNERUNGEN
Eine Liebe, die rührt. Eine Liebe, die beseelt. Eine Liebe, die in Zeiten der Beziehungsoptimierungen bewegt. Eine Liebe, die auch ängstigt. 65 Jahre waren der berühmte amerikanische Psychoanalytiker Irvin D. Yalom und seine Frau Marilyn, eine bedeutende Literaturwissenschaftlerin, verheiratet. Mit 15 lernten sie einander kennen, beide Kinder russisch-jüdischer Einwanderer, beide hochbegabt, beide einander vom ersten Moment an treu ihrer Liebe ergeben bis an das Ende.
Beide hätten gern in einem Sarg gemeinsam die Ewigkeit oder das Nichts verbracht, doch Marilyn starb im Alter von 87 Jahren zuerst. In ihren letzten Monaten schrieben Marilyn und Irvin gemeinsam ihre Liebes-Erinnerungen auf. Das Kennenlernen, die Studienjahre, das Leben mit den vier Kindern und acht Enkeln. Die Angst vor der Einsamkeit des Zurückbleibenden.
Mit 90 Jahren lebt Yalom jetzt das erste Mal allein. Er kann Marilyn nicht erzählen, was ihn umtreibt, wen er traf, was er fühlt, wie es den Kindern geht. Es ist ein tief bewegendes Buch über die ewige Liebe, die ganz große, die beim Verlust genauso unendlich schmerzt, wie sie zuvor beglückte. Ein Lebensbuch über Eros und Seelenglück, das Einswerden in Zweisamkeit und einen Tod, den die Erinnerung hin und wieder vergessen macht. Maria Ossowski
Irvin D. Yalom und Marilyn Yalom: »Unzertrennlich. Über den Tod und das Leben«. Übersetzt von Regina Kammerer. btb,
München 2021, 320 S., 22 €

LYRIK-SOLITÄR
In einem seiner Gedichte, betitelt mit »Nordsee«, erscheint ihm eine plötzlich aufragende Welle wie »ein Hai/ der schiefen Maules mich anfällt«. Doch noch läuft sie aus in beinahe spielerischer Gischt und trägt den Dichter wieder an Land: »Wer im geschmeidigen Sande/ ohne mein Wissen tanzend sich einprägt,/ bin ich.«
1992 erhielt Ludwig Greve, geboren 1924 in Berlin, für seinen Gedichtband Sie lacht den renommierten Peter-Huchel-Preis und wurde endlich wahrgenommen als einer der skrupulösesten Sprachkünstler der deutschen Nachkriegsliteratur. Doch welch grausame Ungleichzeitigkeit: Preis und Preisung erfolgten postum, denn im Jahr zuvor, am 12. Juli 1991, war Greve vor Amrum beim Schwimmen ertrunken.
Seine ersten Gedichte entstanden bereits im Frühjahr 1944 in einem Versteck im italienischen Lucca, wohin er sich und seine schwerverletzte Mutter gerettet hatten. Von der gutbürgerlichen jüdischen Familie hatten nur die beiden überlebt; Vater und Schwester waren von faschistischen Carabinieri festgenommen und an die deutschen Besatzer ausgeliefert worden, die Familie des Onkels hatte man in Südfrankreich verhaftet und nach Auschwitz deportiert.
Ludwig Greve aber kehrte nach Deutschland zurück, fand für drei Jahrzehnte mehr als nur einen Brotberuf im Marbacher Literaturarchiv und schrieb lange nicht über seine Kindheits- und Jugendjahre; der schmerzhaft genaue, filigrane autobiografische Prosaband Wo gehöre ich hin? blieb aufgrund des Unfalltodes Fragment. Aber die Gedichte!
Anrufungen der Schwester und des Vaters aus tiefster Not, hoch konzentrierte Dankeszeilen auf die guten Menschen in Lucca, existenzielle und von jedem konventionellen Symbolismus freie Assoziationsbilder angesichts von Zügen, von Ebbe und Flut ... So stark, so intensiv ist dieses Schreiben, dass es, wie etwa im Gedicht »Hannah Arendt«, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Empathie geradezu fordert: »Abends/ schmeckte ihr das Essen, wenn Freunde kamen/ aus der Welt, sie fand in drei Sprachen Wohnung. Aber von uns wer,/ mitten im Gespräch sich nach vorne beugend,/ kann noch so Gedichte hersagen, deutsche,/ Wort für Wort ... Sie trugen die Bürde, Hannah, nichts verloren.« Es ist Zeit, den Solitär Ludwig Greve endlich wiederzuentdecken. Marko Martin
Ludwig Greve: »Sie lacht und andere Gedichte«. S. Fischer, Frankfurt/M. 1991, 78 S., nur noch antiquarisch erhältlich

IDENTITÄTS-ERFORSCHUNG
Er gilt als Enfant terrible. Vor allem seine »Tempo«-Kolumne »Hundert Zeilen Hass« und das gerichtliche Verbot seines Romans Esra begründeten diesen irgendwann notorisch gewordenen Ruf. Und ja, einige Texte des Schriftstellers und Kolumnisten Maxim Biller können einen Eindruck von Härte und Unnachgiebigkeit erwecken.
Doch eigentlich ist Biller ein geradezu zärtlicher Autor. Wie kein anderer versteht er es, Atmosphäre zu schaffen und den Leser direkt an die Schauplätze seiner schnörkellosen Texte mitzunehmen, kurzum: Kopfkino auszulösen. Am deutlichsten spürbar ist Billers unterschätzte sanftere Seite in seiner 2009 erschienenen Autobiografie Der gebrauchte Jude. Dort erzählt der 1960 in Prag geborene und seit 1970 in Deutschland lebende Autor nicht nur, wie er zu seinem Ruf kam. Die Studienzeit in München und die ersten Schritte als Literat und Journalist, die Station bei der FAZ und die erste Begegnung mit Marcel Reich-Ranicki: In 61 kurzen Kapiteln lässt Biller die entscheidenden Stationen seiner persönlichen und künstlerischen Entwicklung Revue passieren.
Die Erforschung der eigenen jüdischen Identität ist ein Leitmotiv dieses Buchs. Auf dem Cover als »Selbstporträt« bezeichnet, ist es auch ein atmosphärisches Porträt der alten Bundesrepublik mit ihren wesentlichen Metropolen Hamburg, München und Frankfurt am Main.
Vor allem für Nachgeborene ist Maxim Billers leicht und zugleich melancholisch daherkommende Rückschau ein Muss. Im besten Fall kann Der gebrauchte Jude zu einem Lebensbegleiter werden, einer Lektüre, zu der man über Jahre hinweg immer wieder greift. Eugen El
Maxim Biller: »Der gebrauchte Jude. Selbstporträt«. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2009, 176 S., 16,95 €
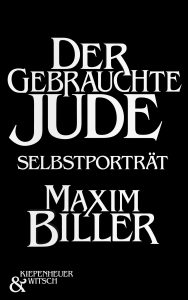
REISE-ABGRÜNDE
54 Tage unterwegs durch Europa – das klingt in Pandemie-Zeiten wie ein Roadtrip aus vergangenen Epochen. 2018 war das noch möglich, und mit angehaltenem Atem begleiten wir Navid Kermani durch Osteuropa, wo sich schon damals nahezu unüberwindbare Risse auftaten, die heute nur noch größer scheinen.
Was Kermanis Reisereportage Entlang den Gräben so packend macht, sind die Begegnungen mit den Menschen. Da ist der Journalist in Warschau, der das Phänomen PiS erklärt; der jüdische Gemeindevorsteher in Kaunas, dessen Eltern trotz der Schoa in Litauen blieben; der Philosoph in Minsk, der kein Blatt vor den Mund nimmt, damals schon skeptisch wegen der politischen Lage in seiner Heimat. Sie alle geben Einblick in eine nationale Vergangenheit, die immer auch eine europäische war – in Polen wie im Baltikum, in Weißrussland, der Ukraine, dem Kaukasus.
Entwurzelung, Gleichmacherei, Entmündigung, Herkunft, Traumata sind die Themen, die Kermani mit seinen Gesprächspartnern streift. Und immer wieder Abgründe. Vor allem der der Schoa, der überall dort klafft, wo Kermani hinter die Fassaden zwischen sozialistischem Plattenbau und dörflicher Idylle schaut. Würden in Kaunas Stolpersteine verlegt, beobachtet er, die ganze Stadt wäre goldglänzend.
Kermani ist ein aufmerksamer Beobachter und ein guter Zuhörer. Er gibt seinen Gesprächspartnern Raum, hält sich selbst zurück. »Wer erinnert sich heute noch?«, fragt eine 97-jährige Schoa-Überlebende in Belarus. Kermani sammelt die Erinnerungen ein, betrachtet sie mit Empathie und Klugheit, verdichtet sie sprachlich brillant zu einem vielstimmigen Mosaik. Es ist vor allem Kermanis erfrischende Unvoreingenommenheit, sein Blick bar jeder Ideologie, die dieses Buch, das zugleich ein leidenschaftliches Plädoyer für ein polyphones Europa ist, so lesenswert machen. Auch und gerade in Pandemie-Zeiten. Katharina Schmidt-Hirschfelder
Navid Kermani: »Entlang den Gräben. Eine Reise durch das östliche Europa bis nach Isfahan«. C.H. Beck, München 2018, 442 S., 14,95 €

KULTUR-GESCHICHTE
Der Historiker Ernst Piper hat einst einen beträchtlichen Teil seines Studiums in den Seminaren des Mittelalterforschers Ernst Pitz an der TU Berlin verbracht, sein umfangreiches publizistisches Œuvre aber ist (abgesehen von einer Savonarola-Biografie) fast ausschließlich dem 20. Jahrhundert gewidmet. Vor einigen Jahren kam Nacht über Europa auf den Buchmarkt, eine »Kulturgeschichte des Ersten Weltkriegs«, wie es im Untertitel heißt. Dabei ist der Gattungsbegriff »Kulturgeschichte« durchaus ernst zu nehmen, denn wer Militärgeschichtliches sucht, wird hier nur bedingt fündig. Vielmehr lenkt Piper den Blick gerade weg vom Schlachtgetümmel – hin zu den kulturellen Strömungen der Zeit. Wie war es möglich, dass die europäischen Eliten, die ein engmaschiges kulturelles Netzwerk unterhielten, mit Kriegsausbruch schlagartig zu erbitterten Feinden wurden? Der Historiker schildert aber auch, wie sich Kriegsgegner aller Seiten den Denkmustern von Feindbildern entgegenstellten.
Ein äußert lesenswertes Kapitel ist mit »Die Lage des Judentums inmitten der Völker« überschrieben. Es war der erste Krieg, an dem die jüdischen Deutschen als gleichberechtigte Staatsbürger teilnehmen konnten. Piper weist nach, dass innerhalb des Militärs keineswegs von Gleichstellung die Rede sein konnte. Von den 33.000 Offizieren, die es im Deutschen Reich gab, waren gerade einmal 16 Juden und die fast ausschließlich in der Bayerischen Armee. Es war die Zeit der Feldrabbiner, wobei der bedeutendste unter ihnen Leo Baeck war, der ausgiebig gewürdigt wird. Auf den europäischen Schlachtfeldern schossen auch Juden aufeinander, während sie in der zionistischen Bewegung die gemeinsame Vision im fernen Palästina einte.
Piper gelingt es, einen abgehobenen akademischen Stil zu vermeiden, ohne in die Abgründe des Populärwissenschaftlichen abzugleiten. Ein Stil also, wie er sich für Strand oder Berghütte eignet, und mit 483 Seiten (ohne Quellenregister) braucht man für diese Lektüre schon einen gesamten Sommerurlaub. Gerhard Haase-Hindenberg
Ernst Piper: »Nacht über Europa«. Propyläen, Berlin 2013, 592 S., 26,99 €










