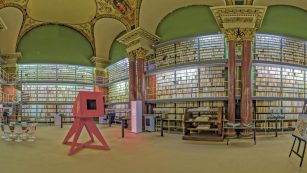Mitte November stellte der Haushaltsausschuss des Bundestages zehn Millionen Euro bereit, um die schon vor Jahren initiierte, aber immer wieder gescheiterte Magnus-Hirschfeld-Stiftung auf den Weg zu bringen. Ziel der Einrichtung ist es, der Diskriminierung von Schwulen und Lesben entgegenzuwirken. Etwa zur selben Zeit wurde bekannt, dass die Sexualmedizinische Ambulanz in Frankfurt, die aus der »Konkursmasse« des dort bis 2006 von Volkmar Sigusch geleiteten Instituts für Sexualwissenschaft übrig geblieben war, bedroht sei. Zwar wurde die Nachricht dementiert, doch seit 2008 ist die Arztstelle in der Ambulanz ebensowenig besetzt wie die nach Siguschs Emeritierung seit vier Jahren vakante Professur.
Die beiden zunächst widersprüchlich erscheinenden Meldungen werfen ein Licht auf die aktuelle Lage der Sexualwissenschaft. Auf der einen Seite wird mit der Stiftungsgründung an den berühmten deutschen Sexualforscher, der sich auch als politischer Aktivist verstand, erinnert. Auf der anderen Seite steht die Marginalisierung der Disziplin, die nur noch in Hamburg, Kiel und Berlin eine eigenständige akademische Existenz führt und zunehmend von der Medizin dominiert wird.
Ansprüche Damit verlängert sich ins 21. Jahrhundert, was schon zur Entstehungszeit der Sexualwissenschaft angelegt war. Diese stand von jeher in Spannung zwischen politischer Bewegung und akademischer Etablierung. Gleich, ob man die Geschichte des Faches wie Volkmar Sigusch mit Paolo Mantegazza, der den Begriff Sexualwissenschaft einführte, beginnen lässt oder erst mit den Forschungen des Hautarztes Iwan Bloch: Immer hatte sich die Disziplin mit politischen Ansprüchen – der Homosexuellen, der Prostituierten oder der Pädophilen – und der Bevormundung durch die Nachbardisziplinen auseinanderzusetzen. Die Medizin, aber auch die Psychiatrie, bemächtigte sich des Körpers, der Sexualität und der Fortpflanzung. Was im frühen 20. Jahrhundert als »abartig« oder »unnatürlich« galt, wird heute als »dysfunktionale Störung« diagnostiziert.
Geschwächt wurde die Sexualwissenschaft aber auch infolge der fortdauernden Zersplitterung in verschiedene Fachgesellschaften. Dass die Pioniere der Disziplin außerdem fast alle aus jüdischen Familien stammten, lieferte den Nazis 1933 den Vorwand, Magnus Hirschfelds berühmtes sexualwissenschaftliches Institut in Berlin als erste wissenschaftliche Einrichtung 1933 zu stürmen und seine Schriften zu verbrennen. Dass Hirschfeld nicht nur Jude, sondern auch Sozialist und wahrscheinlich homosexuell war, machte ihn zur bevorzugten Zielscheibe für die Nationalsozialisten.
Emanzipation Von einer genuin »jüdischen« Wissenschaft könne man, wie Sigusch bereits in seiner voluminösen Geschichte der Sexualwissenschaft (2008) ausführte, dennoch nicht ausgehen. Doch es sei auch kein Zufall gewesen, dass eine diffamierte und um gesellschaftliche Emanzipation ringende Minderheit sich ausgerechnet in diesem »verweiblichten«, »schmutzigen« Fach gesammelt habe. Auf diese Weise seien die jüdischen Anwärter der Medizin von den »anständigen« und »männlichen« Fächern ferngehalten worden.
War es Sigusch in seiner Geschichte bereits Anliegen, »die jüdischen Vorgänger des Faches, die aus dem Land getrieben oder gar ermordet wurden, zu würdigen«, illustriert das nach drei Jahrzehnten intensiver Sammeltätigkeit von ihm zusammen mit Günter Grau realisierte internationale Personenlexikon der Sexualforschung (2009) das Ausmaß des deutsch-jüdischen Beitrags. Von den 199 teilweise bekannten, aber völlig vergessenen Vertretern der Sexualwissenschaft, deren Leben und Werk von 60 Autoren vorgestellt wird, ist eine Vielzahl jüdischer Abstammung.
Dazu gehören nicht nur die umfassend interessierten und politisch engagierten Vordenker wie Mantegazza, Karl Heinrich Ullrichs oder Richard von Krafft-Ebing, sondern auch die eigentlichen Begründer der akademischen Disziplin wie Albert Moll, der wegweisende Studien zur Homosexualität betrieb und die Psychotherapie mitetablierte, der erwähnte Iwan Bloch oder Max Marcuse und Julius Wolf, die in der ersten internationalen Fachgesellschaft den Ton angaben.
Aber auch Praktiker wie der Sozialhygieniker Heinrich Blaschko, der »mit kalter Sachlichkeit und warmer Menschenliebe darum bemüht war, die Diskriminierung der Geschlechtskrankheiten abzubauen«, oder der in gleicher Sache engagierte Julian Marcuse hatten einen jüdischen Hintergrund. Sein bekannter Namensvetter Max wiederum war theoretischer Anstifter der 1968er-Sexpol-Bewegung. Und es gab einige wenige Frauen, die die Sexualreformbewegung vorantrieben.
Perversion Vom gewaltsamen Abbruch der bedeutenden sexualwissenschaftlichen Tradition in Deutschland und Österreich erholte sich das Fach hierzulande nie mehr. Viele Protagonisten emigrierten in die USA, was dazu führte, dass die Sexualforschung nach dem Krieg als amerikanische Erfindung galt – erinnert sei an die Studien von Alfred C. Kinsey oder William H. Masters und Virginia Johnson, die im Lexikon ebenfalls vorgestellt werden. Hans Giese und später Hans Bürger-Prinz, die nach 1945 die Disziplin neu begründeten, waren in den Nationalsozialismus verstrickt, der »jüdische« Anteil musste von den Nachgeborenen erst mühsam freigelegt werden.
Indessen waren die jüdischen Forscher und Praktiker keineswegs immun gegen die Muster ihrer Zeit: Iwan Bloch wollte die Homosexuellen internieren, August Forel, der Direktor der Anstalt Burghölzli in Zürich, forderte, »Eugenik« in den Namen der Fachgesellschaft einzuführen, und selbst der Heroe der Bewegung, Magnus Hirschfeld, plädierte für »die Ausjätung schlechter Menschenkeime«. Die Sexualwissenschaft wirkte, trotz aller aufklärerischen Absicht, immer normierend. Das Sexuelle, zitiert Sigusch Freud, eigne sich nicht »zur guten Substanz«, und was man hofft, wissenschaftlich zu domestizieren, entzieht sich in Form der Perversion.
Volkmar Sigusch, Günter Grau (Hg.): Personenlexikon der Sexualforschung. Campus, Frankfurt/New York 2009. 813 S. 179 €