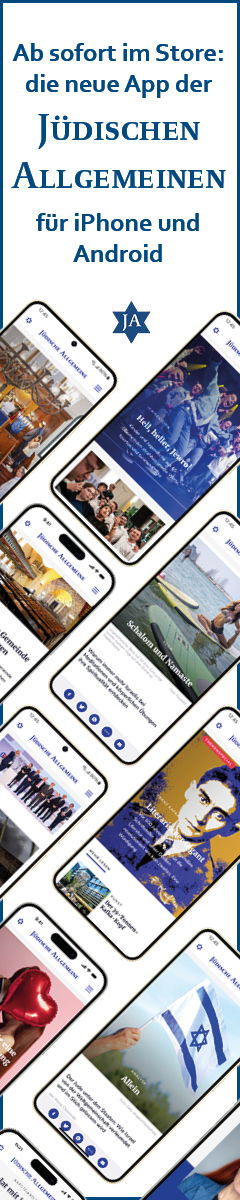Herr Kacholi, Sie haben im vergangenen Herbst Ihr Album »Berlin – Tel Aviv« veröffentlicht. Warum dieser Titel?
Weil das mein Leben ist – Ich will es so! Es ist toll, in zwei Städten zu leben. Jedes Mal, wenn ich nach Berlin reise, merke ich, wie schnell ich wieder in der Stadt ankomme. Es dauert keine Minute! Mir ist das vor Kurzem besonders aufgefallen, als ich mit meinem Kollegen von »Adoro« unser letztes Album promotet habe und zu Gast in verschiedenen Fernsehsendungen war. Es ist für mich mittlerweile normal geworden, Deutsch zu sprechen. Ich erinnere mich noch daran, wie schwer mir vieles fiel, als ich zum ersten Mal in Deutschland war. Es ist erstaunlich, was die Zeit alles bewirken kann. Deutsch ist mittlerweile wie Musik für meine Ohren. Neulich hat mir jemand geschrieben, dass er nie gedacht hätte, ich sei Israeli, weil ich mich für ihn sehr authentisch deutsch angehört habe. Das fühlte sich für eine Sekunde etwas befremdlich für mich an.
Weshalb?
Weil ich dachte: »Hey, ich bin doch auch Israeli und im Hebräischen zu Hause.« Aber ich wusste, dass es ein Kompliment war, und bedankte mich. Nach 15 Jahren in Deutschland fühle ich mich auch in der Sprache angekommen. Meine Heimat wird immer Tel Aviv sein. Aber Berlin war lange Zeit meine zweite Heimat.
Sie sind 2002 zum ersten Mal nach Berlin gekommen. In eine Stadt, die, verglichen mit heute, noch ein ganz anderes Gesicht hatte.
Es gab keine sozialen Netzwerke, keine Smartphones. Ich kam hier an, und das war es. Es war eine gute Zeit, mal abgesehen von meinem ersten Weihnachtsfest hier. Das war ziemlich deprimierend.
Sie waren allein?
Ja. Ich war zu Hause, und die Stadt war leer. Aber ich wusste damals noch nicht, was Berlin zu bieten hat. Ich hätte einfach hinausgehen müssen – nach Schöneberg oder irgendwo anders hin. Viele Cafés haben geöffnet, Tradition und Religion haben die Stadt nicht gänzlich im Griff. Hier kann man vieles sein, und deswegen fühle ich mich in Berlin so wohl. Ich habe mir die Stadt erobert – ohne Facebook, ohne Internet. Ich habe viele Menschen kennengelernt und tolle Produktionen gemacht, wie »Così fan tutte« in der Neuköllner Oper. Als Künstler bin ich in Berlin groß geworden und habe auch meine Karriere mit dem Klassik-Ensemble »Adoro« begonnen. Nach vielen gemeinsamen CDs habe ich mit dem neuen Album nun wieder ein bisschen zu meiner eigenen Identität zurückgefunden. Die israelische Pianistin Efrat Levi, die auch auf »Berlin – Tel Aviv« zu hören ist, hat mich dabei sehr unterstützt.
Zwölf Lieder umfasst »Berlin – Tel Aviv«, darunter Kompositionen von Franz Schubert oder Kurt Weill. Wie haben Sie die Auswahl getroffen?
Ich habe mir Lieder vorgestellt, die meine Persönlichkeit widerspiegeln, zu denen ich eine Verbindung habe und die ich einfach zu singen liebe. 2014 habe ich damit angefangen, das Projekt dann aber wieder in der Schublade verschwinden lassen.
War es Ihnen doch zu persönlich?
Ich denke, ich war nicht mutig genug. Diese Lieder zu singen, setzt viel Hingabe voraus, sehr viel Perfektionismus. Und ich wollte damit richtig zufrieden sein. 2017 habe ich zwei wundervolle Gitarristen aus Israel kennengelernt, Efrat kam dazu, und dann ging es weiter.
Welches Lied steht Ihnen am Nächsten?
Definitiv »Berlin im Licht«. Es erstaunt mich immer wieder, wie sich die Stadt durch Licht verändert. Im Mai beispielsweise. Sie zieht ihren Pullover aus, ist wieder sexy. Aber ich habe auch den dunklen Winter zu schätzen gelernt. Ich mag aber auch Kurt Weills »Wie lange noch« sehr.
Und würde dieses Lied auch in Tel Aviv funktionieren?
Ich denke schon. Kurt Weill, der Komponist von »Berlin im Licht«, ist sehr beliebt. Generell ist Israel sehr offen für Musik. Es gab dort bereits Konzerte mit so großartigen Sängern wie Ute Lemper oder Max Raabe.
Welches ist denn das perfekte Tel-Aviv-Lied?
»Schnei Schoschanim«, würde ich sagen. Der Komponist hat es, glaube ich, in einem Café in Tel Aviv geschrieben – einfach so. Aber ich könnte mir auch »Schir Eres« vorstellen. Es ist ein ruhiges Lied, das ich mit einfacher Stimme singen kann.
Singen Sie anders auf Deutsch als auf Hebräisch?
Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab: dem Stil, der Stimmung, der Melodie. Wenn man ein Stück von Franz Schubert nimmt, hat es eine gewisse Struktur. Man kann beim Singen nicht so viele verrückte Dinge machen. Gefühle und Aussprache haben nur einen geringen Spielraum. Ich habe schon von einigen gehört, dass ich mich wie ein Kantor anhöre, wenn ich auf Hebräisch singe. Vielleicht hat es in der Tat etwas mit der Sprache und dem Text zu tun.
Wenn Sie mit Adoro unterwegs sind, ist alles viel pompöser. »Berlin – Tel Aviv« ist dagegen sehr intim gehalten.
Das gefällt mir auch sehr. Nur meine Stimme und dazu Klavier oder Gitarre. Ich bin nah am Publikum und kann schnell die Reaktionen der Menschen erfassen. Das ist bei einem Adoro-Konzert natürlich anders.
Mit dem Sänger sprach Katrin Richter.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.assafkacholi.com
www.Springstoff.lnk.to/AK_Berlin-TelAviv
Mit Adoro auf Tour:
www.adoro.de/tour