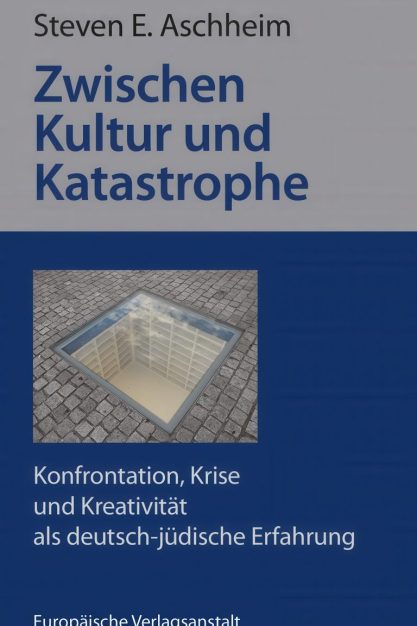Der Jerusalemer Historiker Steven E. Aschheim gilt als Experte, wenn es um das Verhältnis von Juden und deutscher Kultur geht. Vor diesem Hintergrund stellen auch die in dem neuen Sammelband veröffentlichten Aufsätze eine Art Dialektik dar. Sie zeigen einerseits, wie Juden und die deutsche Kultur sich gegenseitig befruchteten, aber auch die Spuren, die die Katastrophen des 20. Jahrhunderts im Denken deutscher Juden hinterlassen haben. Die Texte, allesamt in den vergangenen drei Jahrzehnten entstanden, stehen repräsentativ für zahlreiche Entwurzelungen. Ferner gibt Aschheim im Nachwort Einblicke in die autobiografischen Motive für sein akademisches Interesse.
Denn auch seine Eltern erfuhren eine solche Entwurzelung – es waren deutsche Juden, die vor Hitler nach Südafrika geflohen waren, wo Aschheim 1942 zur Welt kam. Zugleich war sein deutscher Hintergrund damals alles andere als ein Vorteil. Im Nachwort beschreibt er ein Gefühl der Fremdheit, dem er in seiner Forschung stets auf den Grund zu gehen versucht.
Die »Westjuden« glaubten, einer »höheren« Kultur anzugehören, und wollten ungern an ihre armseligen Ursprünge erinnert werden
Als erste Entwurzelung nennt er die Jahrhundertwende, als Juden aus dem Zarenreich nach Deutschland flohen und mit dem Begriff »Ostjuden« etikettiert wurden. Seit der Französischen Revolution hatten sich deutsche Juden von ihren Jiddisch sprechenden Brüdern distanziert, deren Leben im osteuropäischen Schtetl sie für rückständig hielten. Als »Westjuden« glaubten sie, einer »höheren« Kultur anzugehören, und wollten ungern an ihre armseligen Ursprünge erinnert werden, so Aschheim.
Gleichzeitig kehrt er damit zu den Anfängen seiner eigenen Laufbahn zurück. Seine Doktorarbeit schrieb der Historiker über Ostjuden als Projektionsfläche deutscher Juden, die sich so Distinktion erhofften. Zugleich skizziert Aschheim eindrucksvoll, wie schnell sich dann alles ändern sollte. So handelt ein Aufsatz von prominenten jüdischen Intellektuellen, allen voran Walter Benjamin, Gershom Scholem sowie Ernst Bloch und Franz Rosenzweig. Ihnen allen gemein ist der Schock des Ersten Weltkriegs, dessen Verlauf und Folgen das kulturelle Selbstbewusstsein der deutschen Juden massiv erschütterten.
Überzeugend zeigt Aschheim, wie sie die bürgerliche Bildungstradition, der man die jüdische Emanzipation im 19. Jahrhundert zuzuordnen pflegt, unterlaufen konnten. In der Weimarer Republik kamen sie zur Reife, und die Katastrophe des Krieges entzündete einen messianischen Funken in ihrem Denken: Benjamin und Bloch mischen es der Theorie des Marxismus bei. Für Franz Rosenzweig haben Juden sogar eine göttliche Mission jenseits der Geschichte zu erfüllen.
Scholem wandert lange, bevor Hitler an die Macht kam, nach Palästina aus
Gershom Scholem holt die jüdische Mystik wieder hervor und wandert schon lange, bevor Hitler an die Macht kam, nach Palästina aus. In einem anderen Aufsatz zeigt Aschheim, wie nach dem Ende der Weimarer Republik Theodor Adorno, Hannah Arendt und Leo Strauss eine weltweite Wirksamkeit zu entfalten vermochten. Er spricht von ihnen als »grenzüberschreitende Kultfiguren«. Die Entwurzelung, die sie alle erfahren haben, macht sie zu Denkern der Krise, die heute, im 21. Jahrhundert, im wahrsten Sinne des Wortes zu Weltbürgern geworden sind.
Bereits zur Jahrhundertwende versuchte Theodor Herzl, solchen Entwurzelungen entgegenzuwirken. Der Beitrag »Der Zionismus und Europa« verweist auf die Komplexität der jüdischen Nationalbewegung. 2020 erschienen, entstand dieser Text bereits im Schatten der spürbaren Krise in Israel und zeigt, dass die deutschsprachigen Zionisten der ersten Stunde sich keineswegs von Europa abwenden, sondern es – ganz im Gegenteil – in den Judenstaat mitnehmen wollten. Es war ein reiches, aber auch ein schweres Erbe, das sie schließlich in ihr altes neues Land gebracht haben.
Steven Aschheim: »Zwischen Kultur und Katastrophe. Konfrontation, Krise und Kreativität als deutsch-jüdische Erfahrung«. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2024, 266 S., 24 €