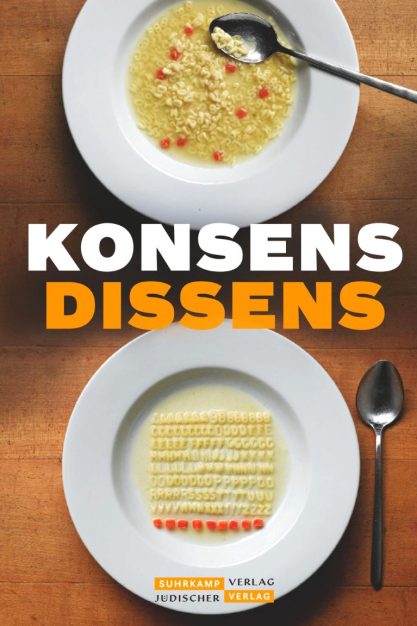Das fast 1000 Druckseiten dicke Bürgerliche Gesetzbuch der deutschen Rechtsprechung ist eindeutig: Bei Konsens und Dissens handele es sich um zwei korrespondierende Willenserklärungen, um Angebot und Annahme, um Angebot und Ablehnung. Konsens steht für Übereinstimmung, Dissens für das Gegenteil.
Schaut man in die Kirchengeschichte, hat es eine auffallende Anzahl von »Dissenters« gegeben, von Abweichenden. Außer den englischen Puritanern, den Anhängern einer fundamentalistischen Sekte, die 1624 aus Trotz in die ihnen komplett unbekannte Neue Welt aufbrachen, um dort nichts Geringeres vorfinden zu wollen als ein Neues Jerusalem, gab es auch Brownisten und Grindletonianer, es gab Sozinianer, Levellers und, als einzig wahre Dissens-Abspaltung, die True Levellers, die einzig wahren Levellers.
schlagwort Unter das Schlagwort »Konsens Dissens« hat nun die in Jerusalem und Tel Aviv lebende Journalistin Gisela Dachs, die vor zwei Jahren an der Hebräischen Universität Jerusalem zur Professorin berufen wurde, die diesjährige Ausgabe des Jüdischen Almanachs gestellt.
Hält Dachs ihr Vorwort noch diskret distanziert und schlägt eher einen einführenden erläuternden Tonfall an, so realisiert man in der dramaturgischen Abfolge und Zusammenstellung, wie der eine Beitrag notwendig auf den nächsten zu folgen hat, wie der zweite Aufsatz mit dem dritten korrespondiert, der dritte Essay den vierten ergänzt, der fünfte den sechsten konterkariert.
Deutlich wird dies bereits in der ersten Hälfte, wenn auf einen Heine-Aufsatz aus der Feder Marcel Reich-Ranickis Ralf Balkes Porträt des österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky folgt, geschmeidiger Seiltänzer zwischen eigenem Judentum und unverstellter Zusammenarbeit mit Ex-Nazis, die er in Ministerämter berief. Als Nächstes zu lesen: ein Essay über Henry Kissinger und dessen Idee von Diplomatie und »Realpolitik«, in deren Unterfutter auch Zynismus eingenäht ist.
SACHA BARON COHEN Danach ein Text über Sacha Baron »Borat« Cohen und dessen Brachial-Entlarvung tief sitzender, unausrottbarer Ressentiments. Was sich noch schärfer liest, da sich Toby Greenes Essay über David Baddiel, den englischen Comedian, und dessen Polemik Und die Juden? anschließt.
Hat der Romanist Yuval Tal aus Jerusalem das inhaltlich etwas ambivalente Glück, über die letzte Präsidentschaftswahl in Frankreich zu schreiben – und über die unverstellte Rückkehr unverstellten Antisemitismus in der offen rassistischen Kampagne des rechtsextremen Lagers –, so war Tal Schneider mit dem Problem konfrontiert, die 36. israelische Regierung, das extra-fragile Acht-Parteien-Bündnis unter Bennett/Lapid, unters Konsens-Dissens-Mikroskop zu legen – sodass Auflösungssymptome größer gerieten, als sie faktisch waren. Aber dann in der Parlamentswahl vom 1. November 2022 in noch größerem Ausmaß bestätigt wurden.
BENJAMIN NETANJAHU Der Politologe Avi Shilon hatte ein fast noch größeres Problem, da ihm auferlegt wurde, eine Porträtvignette des »Bibismus« abzuliefern. Erschien doch Benjamin Netanjahus Autobiografie erst im Oktober 2022 in New York, Monate nach dem Redaktionsschluss des Almanachs. Dass der »Bibismus« sich nach dem jüngsten Erfolg neuerlich leicht anders darstellt, zeigt, wie rasch Gegenwartsanalysen antiquarisch werden können.
»Dissent is the highest form of patriotism«, Dissens ist die höchste Entwicklungsstufe der Vaterlandsliebe. Ein beliebtes, oft weitergereichtes und noch öfters weitergesagtes Zitat des US-Präsidenten Thomas Jefferson (1743–1826). Wobei es allerdings unter Historikern wie auch im Jefferson gewidmeten Museum in Monticello in Virginia keinerlei Konsens darüber gibt, ob dieser Satz tatsächlich von ihm stammt.
Gisela Dachs (Hrsg.): »Konsens Dissens. Jüdischer Almanach«. Mit Beiträgen von Yehuda Bauer, Dan Diner, Michael Wuliger, Noam Zadoff und anderen. Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, Berlin 2022, 220 S., 23 €