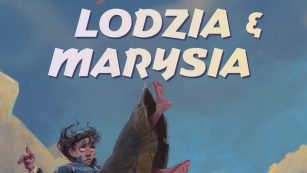Ihre Anfänge sind einfach wunderbar. Kein Rumgeeiere, weder subtiler Stimmungsaufbau noch elegante Annährung, sondern einfach: Bääämm! Nasenspitze an Nasenspitze, mitten rein in die Geschichte, Arschbombe ins Leben.
»Meistens bin ich unbekümmert. Ist auch besser so« eröffnet ihren Bestseller Titos Brille: Die Geschichte meiner strapaziösen Familie. Mit »Mein Sohn David nennt seinen Vater ›Doitscha‹. ›Hey Doitscha! Komm mal runter …‹« beginnt Doitscha: Eine jüdische Mutter packt aus. Oder nehmen Sie »Meine Liebe, willst du wirklich ein ganzes Jahr fortbleiben? Vielleicht löst sich währenddessen Europa auf? Wär’ doch schade drum!« in Das Meer und ich waren im besten Alter: Geschichten aus meinem Alltag.
Adriana Altaras nimmt ihre Leser nicht freundlich bei der Hand, sie rennt vorbei, und wer will, kann mitrennen. Vielleicht deshalb werden ihre Geschichten immer wieder so gern als »hinreißend« beschrieben. Vielleicht auch, weil mancher lieber sitzen bleiben würde?
einlesen Ob mitgerannt oder -gerissen, auch bei Die jüdische Souffleuse verzichtet Altaras dankenswerterweise auf das Sich-Einlesen-Müssen. Mit »Ich will mich nicht beklagen, aber wo immer ich mich gerade aufhalte, fangen die Menschen an, mir ihre Geschichten zu erzählen. Es spielt keine Rolle, ob es regnet, ich mit vollen Einkaufstüten versuche, mein geparktes Auto zu erreichen, oder wie eine Irre renne, um das Flugzeug zu erwischen« geht es los.
Adriana, die Regisseurin aus Berlin, denn Altaras kehrt zuerst immer vor der eigenen Haustür, trifft an einem Theater in der deutschen Provinz die meschuggene Souffleuse Sissele, die beschließt, dass Adriana ihr dabei helfen müsse, ihre Familie wiederzufinden, die sie in der Schoa verloren hat.
Der Weg von der Probebühne zur Selektionsrampe ist auch in diesem Roman nicht weit. Die Schoa ist immer schon da. Wie auch in Altaras’ Beschreibung ihres Vorsprechens an einer deutschen Schauspielschule im Jahr 1978. Ganz großes Kino! Aber lesen Sie bitte selbst.
Wie die Vorgängerbücher, derer gibt es mittlerweile drei und jedes ein Erfolg im eigenen Genre der erweiterten Selbstbeschreibung, platzt auch Die jüdische Souffleuse fast aus dem Einband, wenn es darum geht, der Absurdität des Lebens und Sterbens ein Lachen abzuringen. Egal, wie verzweifelt und trostlos die Situation sein mag. Es ist Altaras’ ausgesprochenes Talent, eben das hinzubekommen, ohne dabei verletzend oder kleinmachend zu werden. Das ist ihrer Ehrlichkeit geschuldet, mit der sie jede Situation zu betrachten sucht, am besten immer aus mehreren Blickwinkeln gleichzeitig. Diesmal ist es übrigens ein Goi, der die jüdischen Witze erzählt. Und das am laufenden Band.
Widrigkeiten Altaras’ kurzweiliges Sich-Abarbeiten an Vergangenheit und Gegenwart und dem ganzen Rest ist beliebt und bekannt aus Titos Brille, wo Altaras ihrer Familiengeschichte nach Kroatien hinterherreist, und ebenso aus Doitscha, wo sie die jüdische Identität auf dem deutschen Abendbrottisch seziert. Aber Die jüdische Souffleuse setzt noch eins drauf.
Mit dem schmalen Roman versucht Altaras nicht weniger, als dem Wesen ihres Erzählens selbst auf den Grund zu gehen. Das ist offensichtlich, entspannt und verspielt, wenn sie die täglichen Widrigkeiten des Opern-Betriebs beschreibt, auf dem Weg zur Aufführung von Mozarts Die Entführung aus dem Serail, und nüchtern existenziell, wenn es um das Schicksal Sisseles geht.
Schon auf den ersten Seiten verrät die Autorin: »Wenn ich mich beim Schreiben bis ins kleinste Detail an die Wahrheit halte und nicht einen Funken hinzudichte, sind meine Leser überzeugt, ich würde fantasieren. Wenn ich etwas hinzuerfinde, zucken sie nicht mit der Wimper und halten es für die reine Wahrheit.« Nur um später über Sisseles Erzählung zu sagen: »Ich wünschte, die Geschichte wäre gelogen.« Ein verständlicher Wunsch, denn Sisseles Geschichte ist ein scharfkantiger Diamant.
Oper Wortwörtlich unfassbar, weil so komprimiert wahr und unheilbar verletzend. Um sie überhaupt erzählen zu können, um sie lesbar zu machen, hat Altaras die Worte dick eingepackt, eingeflochten in die vermeintliche Opern-Selbstbespiegelung. Abgepuffert. In Reinform kann das keiner ertragen.
Plötzlich messen sich Dichtung und Wahrheit, stemmen die gleichen Gewichte, aber natürlich kann die Dichtung nur einpacken, wenn es um die Schoa geht. Da ist kein Weiterkommen. Sackgasse. Daran kann man zerbrechen oder wahnsinnig werden. Oder eben abpuffern. Auf jeden Fall bringt es einen um den Schlaf. Egal, wie viel Zeit vergeht.
»Wir sind verrückt und haben uns daran gewöhnt. Le Chaim!«, heißt das bei Altaras, die mit ihrem Geschichtenerzählen hoffentlich noch lange nicht fertig ist.
Adriana Altaras: »Die jüdische Souffleuse«. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2018, 208 S., 20 €