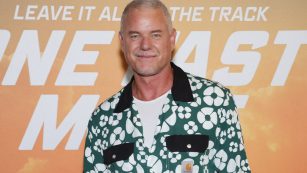Die junge Künstlerin blickt entschlossen. Lee Krasner war gerade einmal 19 Jahre alt, als sie im Sommer 1928 ein Selbstporträt malte, das sie vor der Staffelei im Garten des elterlichen Wohnhauses zeigt. Krasner stand da erst am Beginn ihrer fünf Dekaden umspannenden künstlerischen Laufbahn.
1908 wurde sie als Lena Krassner in Brooklyn geboren. Ihre Eltern stammten aus einem Schtetl nahe Odessa im Russischen Kaiserreich (heute Ukraine). Krasner wuchs mit der jüdischen Tradition auf, ging bewusst in die Synagoge. »Ich war fromm. Ich habe gehorcht«, erinnerte sie sich später. 1922 brach Krasner, die sich inzwischen Lenore nannte, mit dem Judentum. Einige Jahre später wurde die Kunststudentin von ihren Kommilitonen nur noch Lee genannt.
Spätestens in den 40er-Jahren löste sich Krasner von der Gegenständlichkeit. Auch später sollte sie immer wieder Stil und Handschrift wechseln.
Zwischen 1929 und 1933 entstanden weitere Selbstporträts. Neben Aktzeichnungen aus der Studienzeit gehören sie zu den wenigen gegenständlichen Arbeiten, die nun in der großen Lee-Krasner-Retrospektive in der Schirn Kunsthalle Frankfurt zu sehen sind. Die bundesweit erste Überblicksausstellung umfasst mehr als 60 Werke Krasners aus allen Schaffensphasen. Sie wurde zuvor in London gezeigt und wird anschließend nach Bern und Bilbao wandern.
LIEBE Spätestens in den 40er-Jahren löste sich Krasner von der Gegenständlichkeit. Auch später sollte sie immer wieder Stil und Handschrift wechseln. Die Entwicklung von der Figuration zur Abstraktion haben auch Krasners Kollegen Mark Rothko und Jackson Pollock beschritten. Dieser Weg führte zum Abstrakten Expressionismus. Pollock und Krasner trafen sich 1942 in einer Ausstellung. »Ich verliebte mich in ihn – körperlich, geistig – in jeder Beziehung des Wortes«, schilderte sie später. 1945 heirateten die beiden Künstler und wohnten in einem Bauernhaus in Long Island.
Sie beeinflussten sich gegenseitig, doch der künstlerische Ruhm kam vor allem Pollock zu. Krasner stand im Schatten ihres berühmten Ehemannes. »Ich habe vor Pollock, während Pollock, nach Pollock gemalt«, stellte sie einmal klar. In den 40ern entstanden Krasners »Little Images«. Die kleinformatigen, abstrakten Gemälde lassen an Mosaiken denken. Sie wirken mitunter zaghaft.
1956 starb Jackson Pollock bei einem Autounfall. Krasner wurde zu seiner Nachlassverwalterin und übernahm sein großzügiges Atelier in Springs. Auf die Frage, wie sie trotz ihrer Trauer arbeiten könne, antwortete die Künstlerin: »Die Malerei lässt sich nicht vom Leben trennen.« Sie wolle leben – und malen.
»Ich möchte, dass ein Gemälde atmet und lebendig ist«, sagte Lee Krasner einmal.
Als 1959 auch ihre Mutter stirbt, geriet Krasner in eine tiefe Depression. Ein Jahr später vollendete sie, wegen ihrer damaligen Schlaflosigkeit nachts, das große Querformat »The Eye is the First Circle«. Die schiere Wucht von Krasners Pinselgesten ist in Frankfurt körperlich erfahrbar. Das Bild zählt zu den Höhepunkten der Ausstellung.
Ein weiteres Glanzstück ist das abstrakte Gemälde »Combat« aus dem Jahr 1965. Es strahlt in Magenta und Orange, strotzt vor Dynamik und Schwung. In den 60ern entwickelte Krasner ihre Malweise weiter. Einige abstrakt-expressionistische Bilder aus dieser Zeit drohen ins Gefällige zu kippen. In den 70ern begann sie, strenge Farbflächenkompositionen zu malen.
GRABSTEIN Die Eröffnung ihrer Retrospektive im New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) im Dezember 1984 erlebte Krasner nicht mehr. Sie starb sechs Monate zuvor. Krasner wurde in Springs neben Jackson Pollock bestattet. Im Juni 1985, ein Jahr nach ihrem Tod, wurde nach jüdischer Tradition Krasners Grabstein enthüllt.
»Ich möchte, dass ein Gemälde atmet und lebendig ist«, sagte Lee Krasner einmal. Sie fasste das als Ansporn auf: »Wollen wir mal sehen, ob ich es schaffe.« In Frankfurt lässt sich gerade eindrücklich erfahren, dass ihr das gelungen ist.
»Lee Krasner«, bis 12. Januar 2020, Schirn Kunsthalle Frankfurt