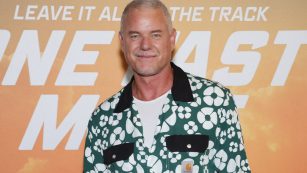Interviews mit Zeitzeugen von NS-Verbrechen stehen längst im Internet. Im Netz sind außerdem digitalisierte Dokumente zum millionenfachen Mord an Juden zu finden, etwa auf den Portalen von KZ-Gedenkstätten. Aber einem Zeitzeugen, der in Form eines Hologramms auftritt, Fragen über Leid und Verfolgung stellen? Auch das ist bereits möglich. Solche Formen eines »digitalisierten Gedächtnisses« behagen allerdings nicht jedem – zumal im Zusammenhang mit der Schoa.
So findet es der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik »gespenstisch«, wenn Zeitzeugen virtuell als Hologramme auftreten. Ende vergangenen Jahres sagte er in Berlin, dass er zudem das Risiko der Manipulation von Fotos und anderen Dokumenten sehe. Damit sei »Holocaustleugnung und Geschichtsverfälschung« Tür und Tor geöffnet. Anders sei es dagegen, wenn Fakten digital zugänglich gemacht würden.
ARCHIVMATERIAL Wenn hier von Digitalisierung die Rede ist, ist vieles gemeint: Archivmaterial ganz unterschiedlicher Art in ebenso unterschiedlichen Datenbanken; Videos mit Berichten von Zeitzeugen; Biografien von Opfern der Schoa; virtuelle Rundgänge durch Städte während der NS-Novemberpogrome. Besonders groß sind die Sammlungen von Zeitzeugeninterviews – weltweit gibt es nach Angaben der Berliner Historikerin Alina Bothe etwa 100.000.
Den Zeitzeugen Pinchas Gutter gibt es auch als virtuelle, dreidimensionale Aufnahme seiner selbst.
Und dann sind da die umstrittenen Hologramme. Im Internet gibt es Videos, in denen der Zeitzeuge Pinchas Gutter als virtuelle, dreidimensionale Aufnahme seiner selbst in einem Sessel sitzend zu sehen ist, während ihm echte Menschen Fragen stellen.
Bothe zufolge ist das Hologramm in Museen in den USA bereits im Einsatz. Gutter hat in realen, stundenlangen Gesprächen rund 2000 Antworten auf Fragen gegeben, die ihm gestellt werden könnten – zu seiner Biografie oder Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg. Eine Software ordnet der realen Frage eines Menschen eine möglichst passende Antwort zu.
VIRTUELL »Das ist ein abgeschlossenes Projekt«, sagt Bothe. Von vornherein sei klar, dass der virtuelle Gutter sich nur im Rahmen der aufgenommenen Antworten äußern könne und nicht zu aktuellen Themen. Und der reale Gutter wisse, dass seine Äußerungen nur für dieses Projekt genutzt würden.
Dagegen ist es bei Interviewaufnahmen mit Zeitzeugen mitunter so, dass diese Videos irgendwann auf Youtube stehen und nicht nur in einer speziellen Datenbank, wie Bothe betont. Das sei vielen Interviewten zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht klar gewesen. Bei Beschwerden würden Videos durchaus entfernt.
Die Gefahr der Manipulation von Videos ist gegeben.
Allerdings dürfte wegen der sich schnell entwickelnden technischen Möglichkeiten auch nicht klar sein, was mit Äußerungen eines als Hologramm auftretenden Menschen künftig geschehen könnte. Die Gefahr der Manipulation von Interviews jedenfalls ist in Einzelfällen gegeben, wie Bothe betont: »Wir sehen, dass Material neu zusammengesetzt wird« – dabei durchaus sinnentfremdend.
MANIPULATION Hier müssten Interviews technisch besser vor Manipulationen geschützt werden, fordert Bothe. Im Fall von Verunglimpfungen und hasserfüllter Rede in Kommentarspalten zu Zeitzeugeninterviews, die im »großen Stil« vorkämen, sieht sie Konzerne wie Youtube in der Pflicht, dies zu unterbinden. Das Manipulationsrisiko sowie damit verbundene ethische und technische Fragen seien große Herausforderungen beim Thema »Digitalisierung des Gedächtnisses«.
Am besten wäre es ohnehin, wenn für Interviews etwa mit Hilfe von Gedenkstätten eine zentrale, internationale Datenbank auf die Beine gestellt würde, sagt Bothe. »Mein Eindruck ist, dass es daran ein großes Interesse gibt.« Derzeit gebe es zahlreiche Einzelportale unterschiedlicher Qualität, die Zeitzeugenberichte anböten.
Interviews müssen technisch besser vor Manipulationen geschützt werden, fordern Experten.
In nicht allzu ferner Zukunft werden die letzten lebenden Zeitzeugen sterben – und es wird kaum eine andere Möglichkeit bleiben, als sich virtuell mit ihren Zeugnissen zu beschäftigen. Etwa in der Schule. Aber schon heute werde dem Digitalen ein »pädagogischer Wert« beigemessen, so Bothe.
Denn zahlreiche Menschen bekämen nie die Möglichkeit, zu einer Gedenkstätte zu reisen. Virtuell aber schon. Zum Beispiel in das Amsterdamer Hinterhaus, in dem sich Anne Frank versteckt hielt – über einen »Rundgang« auf der Internetseite.