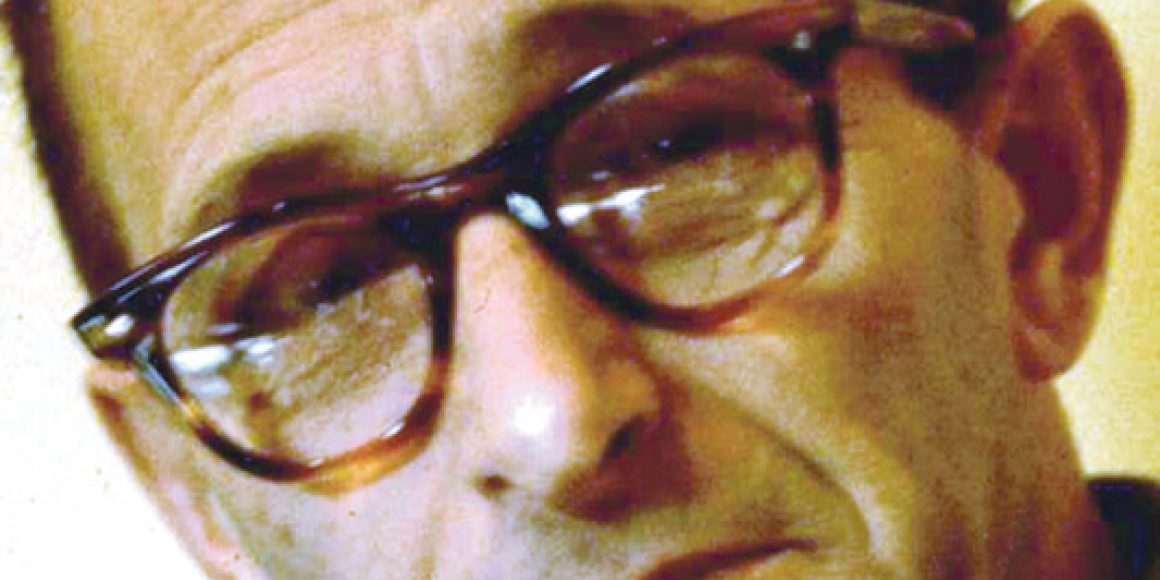Es scheint, als sei es gerade eine erschreckende Verwandtschaft der deutschen Gesellschaft zu ihrem »Bruder Eichmann« (Heinar Kipphardt), die eine Erforschung des Massenmörders als Bürokrat so schwierig macht. Zu nah wäre er der Mehrheitsgesellschaft, als dass man sich ihm mit der erforderlichen Distanz des Analytikers nähern könnte. »Banal« erschien Hannah Arendt der millionenfache Mörder in ihrem Klassiker Eichmann in Jerusalem.
Bettina Stangneth hat nun das Buch Eichmann vor Jerusalem geschrieben, und was die Philosophin und Historikerin bearbeitet, ist genau die Frage nach der Nähe Eichmanns, nach dem Wissen, das die deutsche Gesellschaft vor dem Jerusalemer Prozess, vor Eichmanns Entführung aus Argentinien, vor den Nürnberger Prozessen, also während des NS-Terrors, über Eichmann hatte.
Eichmann selbst hat sich bekanntlich in Jerusalem und in seinen Schriften als jemand präsentiert, der ein kleines Rädchen war, andere NS-Größen hätten ihn zum Popanz erhoben. »Meine Prominenz bis 1946 war gleich null«, hat Eichmann 1962 notiert, erst der SS-Mann Wilhelm Hoettl habe ihn durch seine Aussage in Nürnberg »zum Mörder von fünf oder sechs Millionen« gestempelt.
Zieht man den selbstentlastenden Aspekt der Aussage ab, ist das in der Tat hiesige Mehrheitsmeinung: Eichmann soll ein unbekannter Schreibtischmörder gewesen sein. Einer, der die Vernichtung quasi anonym organisierte, von dem und von der man ja nichts wissen konnte.
pöbelnder antisemit Bettina Stangneth hat mit ihrer Fleißarbeit Hunderte, ja Tausende Belege zusammengetragen, die zeigen sollen, dass Adolf Eichmanns Name vor 1945 und danach vielen Deutschen vertraut war, ja dass sein Name und seine Funktion einem größeren Teil der Weltöffentlichkeit bekannt war. Stangneths Methode ist die der Naivität.
Ihr fiel auf, dass, als Israels Premierminister David Ben Gurion 1960 die Verhaftung Eichmanns bekannt gab, nicht etwa Fragen, wer dieser Mann wohl war, veröffentlicht wurden, sondern sofort Betrachtungen über dessen Charakter folgten. »Der scheinbar Unbekannte« hatte, fiel Stangneth auf, »schon mehr Spitznamen als die meisten Nazis: Caligula, Zar der Juden, der Endlöser, Bürokrat und Massenmörder«.
Die Autorin erinnert beispielsweise an eine Geschichte aus dem Jahr 1937, als Eichmann die Abschiedsfeier für Rabbiner Joachim Prinz in Berlin sprengte und sich so der jüdischen deutschen Öffentlichkeit als ekelhafter, pöbelnder und von keinen Hemmungen gebremster Antisemit präsentierte; als einer, den man sich merken musste.
Eichmann war öffentlich und wollte es sein. Er war für jeden erkennbar dem Führungs- und Verwaltungsapparat des NS-Regimes zugehörig. Eichmann, schreibt Stangneth, war »das Gesicht der Judenpolitik Hitlers«. Und dass er auch in seinem argentinischen Fluchtort keineswegs ganz tief abgetaucht war, sondern nicht nur dem niederländischen SS-Mann Willem Sassen stolz ein Interview über seine Taten gab, sondern sogar einen Offenen Brief an Bundeskanzler Adenauer schrieb, zeigt, dass Eichmann auch nach 1945 sein wollte, was er ganz offensichtlich war: ein großer, bedeutender Nazi und Mörder.
Schon der Umstand, dass Eichmann vom Vorgänger des BND, dem »Amt Gehlen«, angeheuert wurde, zeigt, dass er da war, bekannt war und als bedeutend galt. Gerade die Zeit zwischen 1945 und 1960, als Eichmann als untergetaucht galt, wird von Stangneth ausführlich beschrieben.
kalkül Was Adolf Eichmann dann in Jerusalem, als ihm 1961 der Prozess gemacht wurde, veranstaltete, war laut Stangneth ein simpler »Rollenwechsel«. Er wollte als Bürokrat mit Befehlsnotstand gelten, wie ihn auch Hannah Arendt analysierte – schlicht, um seine Haut zu retten. Gewiss, die These, dass dies Eichmanns Kalkül war, wurde schon vor Stangneth vertreten; dass sie dies nicht gesehen hätte, ist ja der zentrale Vorwurf an Hannah Arendt.
Was Bettina Stangneth aber leistet, ist doppelt bedeutsam: Zum einen liefert sie am Beispiel Eichmann einen ungeheuer wichtigen Beitrag zur Erforschung der Frage, wie viel – nämlich sehr viel – in der deutschen Öffentlichkeit über den Massenmord an den Juden bekannt und wie groß folglich die nach 1945 einsetzende Verdrängung war. Zum anderen tut sie dies nicht in einer Hannah Arendt verdammenden Weise – schon der Titel ihrer Studie erinnert ja an Arendts Großwerk –, indem sie Arendt gleichsam auf eine neue Stufe hebt.
Bettina Stangneth: Eichmann vor Jerusalem. Das unbehelligte Leben eines Massenmörders. Arche, Zürich Hamburg 2011, 656 S., 39,90 €