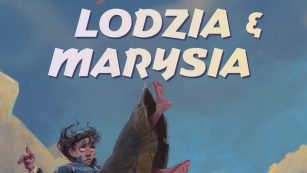Wird Syrien das nächste Afghanistan? Diese Frage beschäftigt viele seit dem Sieg des Bündnisses Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – auf Deutsch: »Organisation zur Befreiung Syriens« – Anfang Dezember über Diktator Baschar al-Assad. Denn die Sorge besteht, ganz Syrien könnte unter die Herrschaft von Islamisten fallen, die Minderheiten und Frauen grundlegende Rechte verwehren. Auch für andere Staaten könnte ein neuer, extremistischer Nachbar zur Gefahr werden.
Doch Syrien, so entgegnen viele Syrer, sei nicht Afghanistan, sondern diverser und progressiver. Die Gesellschaft dort würde sich keine Gender-Apartheid à la Taliban aufzwingen lassen. Diesen Unterschied zwischen den beiden Ländern unterstreicht auch der syrische Journalist Muhammad al-Kayyal in der Zeitung »Al-Quds al-Arabi«. Doch ein Grund zur Beruhigung sei das nicht, so Kayyal weiter. Denn Syrien sei »immer noch Syrien«. Das Land habe in den vergangenen Jahrzehnten einen sichtbaren Hang zu extremen Ideologien gezeigt, beispielsweise dem syrischen Nationalismus, Baathismus, Islamismus und dem Salafi-Dschihadismus.
Aus Letzterem stammt auch Syriens neue (Übergangs-)Regierung um die HTS. Ihr Anführer Ahmad al-Sharaa alias Abu Muhammad al-Dscholani war einst syrischer Statthalter von Abu Bakr al-Baghdadi, dem früheren »Kalifen« des sogenannten Islamischen Staates (IS). Ende Januar wurde er von der Übergangsregierung zum Interimspräsidenten Syriens ernannt. Was kann man von der Herrschaft der HTS erwarten?
Keine Massaker während des Umsturzes
Positiv ist erst einmal die Tatsache zu bewerten, dass es in den elf Tagen, die man brauchte, um Assad zu stürzen, offenbar keine Massaker gab. In dieser Phase geschahen bei Angriffen auf kurdische Gebiete in Nordsyrien die größten Menschenrechtsverletzungen, und diese gingen von türkisch gesteuerten Milizen aus, nicht von der HTS.
Die oftmals bei Umstürzen zu beobachtenden Racheorgien an den Unterstützern des alten Regimes oder an Minderheiten fanden nicht statt, trotz einer Reihe von Gewalttaten, bei denen schwer abzugrenzen war, ob sie gegen Minderheiten oder aus ihren Reihen stammende Schergen des Regimes gerichtet waren. Ein friedlicheres Ende für den 14-jährigen Bürgerkrieg mit über 500.000 Toten wäre kaum denkbar gewesen.
»Pragmatisch« lautet oft das erste Wort, wenn nun über die neuen Machthaber in Damaskus geschrieben wird. In der Tat reden die konservativen Männer mit den langen Bärten, die jetzt am Ruder sind, nicht erst seit der Übernahme des Landes von der »Mentalität des Staates«, von »Zusammenleben« und von »Stabilität«.
2020 riss HTS die Brücke zum Dschihadismus ab
Der Weg dorthin war lang. Er begann 2013 mit dem Bruch zwischen Ahmad al-Sharaa, damals noch unter seinem Kampfnamen Abu Muhammad al-Dscholani, und dem IS und setzte sich mit der Abspaltung von al-Qaida 2016 fort. 2020 riss HTS die Brücke zum Dschihadismus ab und liquidierte die letzte offizielle al-Qaida-Zelle in der Stadt Idlib.
Manche Beobachter spekulieren über eine »post-ideologische« Form des Salafismus.
Experten wie Jerome Drevon oder Aaron Y. Zelin sind davon überzeugt, dass diese Abkehr der HTS vom Dschihadismus ernst gemeint ist. Andere spekulieren sogar über eine »post-ideologische« Form des Salafismus, ähnlich dem Wandel in der saudischen Monarchie.
Und tatsächlich hatte die HTS in Idlib bereits unerwartete administrative Kompetenz gezeigt. Dort hatte sie 2017 die sogenannte Erlösungs-Regierung für Syrien verkündet und die Verwaltung in zivile, aber loyale Hände übergeben. Dank enger Kooperation mit Ankara gelang ihr ein wirtschaftlicher Wiederaufbau, bei dem das kleine Idlib selbst die alten, unter Assad jedoch völlig heruntergekommenen Metropolen Damaskus und Aleppo hinter sich ließ.
Die neuen Machthaber sprechen vom »Übergang« hin zu einer Verfassung und Wahlen, von Entwicklung und Wiederaufbau
Die neuen Machthaber setzen dieses Muster fort, sprechen von einem »Übergang« hin zu einer Verfassung und Wahlen, von Entwicklung und Wiederaufbau. Auf öffentliche Kritik, beispielsweise am Zeigen islamischer Banner neben der Nationalflagge, wird mitunter reagiert. So verschwanden diese rasch wieder.
Ahmad al-Sharaa absolviert unterdessen mit beeindruckender rhetorischer Souveränität TV-Interviews in der arabischen Welt: Syrien wolle keinen Krieg. Das Land müsse aufgebaut werden und benötige internationale Kooperationen. Syrien sei ein Land für alle seine Bürger. Man wolle sich auch nicht in die Angelegenheiten der Nachbarn einmischen. Auch mit Israel wünsche man keinen Konflikt, sagte Ende Dezember zumindest der neue Gouverneur von Damaskus.
Bei seiner ersten Rede als Übergangspräsident Ende Januar versprach Ahmad al-Sharaa erneut freie Wahlen und die Einbindung »aller Teile Syriens« in den »nationalen Dialog«. Sein erster Auslandsbesuch am 2. Februar ging nach Saudi-Arabien, ein Land, das sich zuletzt stark gegen zerstörerische ideologische Projekte in der Region gestellt hat. Alles wunderbar also?
Alles wunderbar also? Keinesfalls!
Keinesfalls, denn es gibt auch negative Anzeichen. Zunächst einmal ist die HTS bis heute als Terrororganisation gelistet. Auch war ihre Herrschaft in Idlib nicht demokratisch, sondern autokratisch und unterdrückte Kritik und Widerstand. Dieselben Experten, die die politische Deradikalisierung der HTS loben, weisen darauf hin, dass sich das von salafistischen Klerikern definierte ideologische Fundament kaum verändert habe. Es bleibe ultrakonservativ-patriarchal. Die salafistische Engstirnigkeit sei zwar ein wenig gelockert worden, aber der absolute Überlegenheitsanspruch der Religion über Politik und Kultur sei weiterhin vorhanden.
Beispielhaft dafür ist die seit 2022 stattfindende Buchmesse in Idlib, die einerseits positiv als Zeichen zivilen Aufbruchs rezipiert wurde. Andererseits, so der Journalist Hossam Jazmati, fand sich dort neben Romanen und universitären Fachbüchern auch reichlich dschihadistische Indoktrinations-Literatur.
Problematisch sind ebenfalls mit der HTS kooperierende Einheiten internationaler Dschihadisten aus Tadschikistan oder China und die Soldateska der von der Türkei unterstützten Syrischen National-Armee (SNA). Und selbst im Jahr 2024 werden in Idlib immer noch jesidische Frauen gerettet, die 2014 vom IS entführt und versklavt wurden. Zwar kooperierte die HTS-Verwaltung bisweilen bei ihrer Befreiung. Trotzdem wirft das ein Licht auf die Art von Gesellschaft, die dort unter dem HTS-Regime existierte. Die Situation der Christen und Drusen bleibt ebenfalls prekär.
Spannungen zwischen den HTS-Machthabern und der alawitischen Minderheit
Die Spannungen zwischen den HTS-Machthabern und der alawitischen Minderheit dagegen, der früheren Machtbasis von Baschar al-Assad, sind im Januar wieder gestiegen. Obwohl manchmal unklar bleibt, von wem sie ausgegangen sind – sicher ist, dass die Minderheit am Ende den Kürzeren ziehen könnte.
Seit der Machtübernahme hat die HTS ihre Übergangsregierung mit ultrakonservativen Kadern besetzt – unter anderem mit einem Justizminister, dem die Journalistenplattform verify-sy die Beteiligung an der Hinrichtung zweier mutmaßlicher Prostituierter wegen »Unzucht« im Jahr 2015 nachgewiesen hat. Zwar hat man auch Frauen in hohe Ämter eingesetzt, beispielsweise die Direktorin der Zentralbank. Die neue Beauftragte für Frauen- und Familienangelegenheiten dagegen, Aisha Dibs, verkündete sofort, dass sie nichts akzeptiere, was Frauen außerhalb ihrer »naturgegebenen Rolle« sehe.
Die für wenige Monate vorgesehene Periode der Übergangsregierung wurde bereits jetzt auf vier Jahre verlängert. Es ist klar, dass das eigentliche Ziel der HTS kein säkulares Syrien ist, sondern ein politisch-islamisches Syrien. Was das konkret bedeutet, darüber darf spekuliert werden. Womöglich will man sich an der AKP-Regierung in der Türkei orientieren, nur ohne den lästigen türkischen Laizismus. Das würde einerseits eine pragmatische Wirtschafts- und Außenpolitik bedeuten, die nationale Interessen in den Mittelpunkt rückt, und weniger die ideologischen Dogmen.
Säkulare Freiräume nur im Privaten
Andererseits soll eine islamisch ausgerichtete Gesellschaft entstehen, die säkulare Freiräume nur im Privaten zulässt. Sunnitische, arabische Muslime würden in diesem Syrien die alles bestimmende Rolle einnehmen. Andere Gruppen, darunter Kurden und Drusen, müssten sich demzufolge unterordnen. Auch wenn es Wahlen geben wird, wäre ihr Zweck tendenziell die Bekräftigung der patriarchalen Führungsfigur, also Ahmad al-Sharaa. Die Gesetzgebung wäre stets religiösen Leitlinien untergeordnet.
Dieses Syrien nach Erdogan-Vorbild würde eine regionale Wiederbelebung für den Islamismus bedeuten. Trotz der Beteuerungen der HTS-Regierung, sich nicht in die Angelegenheiten der Nachbarn einzumischen, würde Syrien nämlich zum Vorbild für Gleichgesinnte werden. Gegenüber Israel ist die ideologische Perspektive der HTS ebenfalls klar, trotz der bisher vorsichtigen Politik gegenüber dem Land: Man sieht die Hamas als Helden. HTS-Anführer Ahmad al-Sharaa selbst hat seinen Weg zum Dschihadismus öffentlich mit dem Eindruck von Fernsehbildern aus der Zweiten Intifada erklärt.
In Israel betrachtet man die neue Regierung in Syrien langfristig als Brückenkopf der Türkei.
In Israel betrachtet man dementsprechend die neue Regierung in Syrien kurzfristig als eine dschihadistische Gruppe. Langfristig aber sieht man die Gefahr, das Land könne zu einem Brückenkopf der Türkei werden, dem potenziellen »neuen Iran« in der Region. In diesem Licht sind auch die Luftangriffe gegen die militärische Infrastruktur sowie die Besetzung von syrischem Territorium seit dem Fall von Assad zu sehen, und das, obwohl die HTS bisher keine Aggressionen gegenüber Israel verübt hat.
Präemtive Vorwärtsverteidigung
Sogar ausgewiesen nüchterne Experten wie Eyal Zisser vom Moshe Dayan Center in Tel Aviv sehen diese »präemtive Vorwärtsverteidigung« daher kritisch. Doch nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 ist klar, dass in Israel das Motto gilt: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ob diese Einschätzung gerechtfertigt ist oder nicht, wird die Zukunft zeigen. Im Interview mit »The Economist« wurde al-Sharaa gerade konkret gefragt, ob er die Normalisierung mit Israel wünsche. Syrien wolle »Frieden mit allen Nachbarn«, antwortete al-Sharaa, um danach noch umständlich die »legalen« und »territorialen« Sensibilitäten auf syrischer Seite zu betonen, die so einer Entwicklung im Weg stünden.
Doch zunächst einmal wird die HTS weiterhin versuchen, ihre Herrschaft über Syrien überhaupt erst zu konsolidieren. Denn die Kurden (Syrische demokratische Kräfte, SDF) kontrollieren mit westlicher Unterstützung immer noch den Nordosten des Landes. Und die Drusen im Südwesten haben mit ihren eigenen Milizen den Einzug von Truppen der HTS bisher blockiert.
Was wäre in dieser Hinsicht wünschenswert für die Zukunft? Sollte Syrien sofort »wiedervereinigt« werden, oder wäre es nicht eher im Interesse der Kurden und Drusen, ihr militärisches Potenzial als Faustpfand für Garantien auf Rechte, Formen der Mitsprache oder Selbstbestimmung beizubehalten? Welche Motivation könnten Minderheiten überhaupt haben, sich einer arabisch-muslimischen Mehrheit zu unterwerfen? Denn diese hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder bewiesen, wie schlecht sie mit Minderheiten umzugehen bereit ist.
Der Autor ist Historiker, Nahostexperte und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Graduiertenkolleg »Ambivalent Enmity« an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg und der Universität Heidelberg.