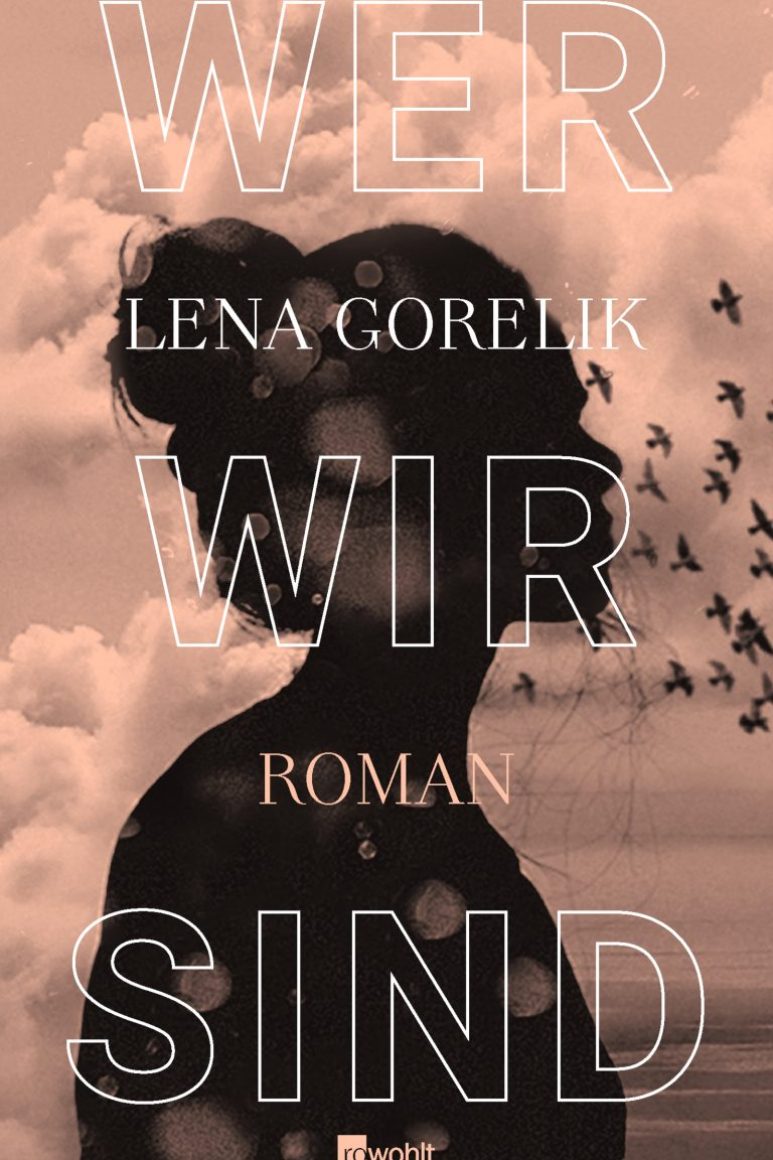Wer wir sind ist der Titel des neuen, autobiografischen Romans von Lena Gorelik. Schon zu Beginn zeigt die Ich-Erzählerin, die alle wesentlichen biografischen Daten mit der Autorin teilt, warum das Buch nicht etwa »Wer ich bin« heißt. Sie macht den Leser mit einem erst einmal unschuldig klingenden sowjetischen Ausspruch vertraut, der besagt, »я« sei der letzte Buchstabe im Alphabet. »я« bedeutet im Russischen zugleich »ich«.
Sobald man das weiß, erhält der Satz einen anti-individualistischen Sound. Denn er lautet dann sinngemäß: »Ich ist der letzte Buchstabe im Alphabet.« In diesem Geist wurden mehrere Generationen sowjetischer Kinder erzogen, auch die 1981 in Leningrad (heute: Sankt Petersburg) geborene Schriftstellerin und Publizistin Lena Gorelik.
Mit dieser Sentenz skizziert Gorelik die zentrale Entwicklungslinie ihres Romans. Es ist die Reise der Ich-Erzählerin Lena vom spätsowjetischen »Wir« über den jugendlichen Versuch der Loslösung von der eigenen Herkunft hin zur späteren emotionalen Hinwendung zur Familie und ihrer Geschichte als erwachsene Frau und Mutter. »Wer wir sind« heißt in erster Linie: wir, die jüdische, aus Leningrad stammende, seit 1992 in Deutschland lebende Familie Gorelik.
signal Die Erzählerin stemmt sich als Kind gegen den Ausspruch, »ich« sei der letzte Buchstabe im Alphabet, um ihn später anzunehmen: »Ich will aber: diese Geschichte erzählen. Ich wünsche, dass diese Geschichte mir gehört. Heute bin ich für diesen Satz dankbar, natürlich.« Auffällig ist auch, dass Gorelik den Satz im kyrillischen Original schreibt, wie eigentlich alle im Roman vorkommenden russischen Wörter, Begriffe und Ausdrücke. Es ist ein selbstbewusstes Signal der Autorin, ihre Muttersprache nicht zu verstecken und sie dem womöglich russischunkundigen Leser zuzumuten. Eine sprachliche Hürde entsteht aber nicht, denn Gorelik erklärt und übersetzt sämtliche Vokabeln.
Bezeichnend ist, dass die dem Romantext vorangestellte Widmung nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Die drei kurzen russischen Sätze lauten: »Der Mutter und dem Vater. Danke euch. Für absolut alles.« Auch wenn Gorelik stets die subjektive Perspektive ihrer Ich-Erzählerin beibehält, bilden deren Eltern einen festen Bezugspunkt. Ob es der Vorwurf der Mutter ist, Lena habe keinen Sinn für Familie, oder der von der Erzählerin vermutete Gedanke des Vaters, die Tochter habe als Schriftstellerin keine richtige Arbeit: Die individuelle Geschichte der Ich-Erzählerin entfaltet sich im Spiegel des mehrere Generationen umspannenden Familien-»Wir«.
Gorelik springt dabei durch die Zeitebenen. Die Corona-Gegenwart scheint ebenso auf wie die Sowjetunion mit all ihren Zumutungen und der Zweite Weltkrieg mit der furchterregenden Blockade Leningrads durch die Wehrmacht. Dem 2. Mai 1992, an dem die Goreliks kurz vor Mitternacht Sankt Petersburg mit dem Zug nach Deutschland verlassen, um dem grassierenden postsowjetischen Judenhass zu entfliehen, ist ein eigenes Kapitel gewidmet.
STRESS Der für ein Kind geradezu magische Moment, das bisherige Leben hinter sich zu lassen und zu etwas Neuem, Unbekanntem aufzubrechen, brennt sich vielen Auswanderern in die Erinnerung ein. Die Elterngeneration verbindet damit oft emotionalen Stress angesichts der erdrückenden Ungewissheit: »Wir wussten nichts über den Alltag in Deutschland, kannten nur vage Gerüchte von jenen, die vielleicht jemanden kannten, der jemanden kannte, der ausgewandert war und Briefe geschickt hatte.«
Eindrücklich rückt Gorelik die emotionalen und psychischen Kosten der Emigration für die Eltern und Großeltern in den Fokus. Zum einen wirkt sich die Nichtanerkennung ihrer beruflichen Leistungen und Studienabschlüsse geradezu degradierend aus. Die für viele letztlich unüberwindbare Sprachbarriere und der durch nichts zu tilgende Akzent im Deutschen kommen hinzu – samt den Bemerkungen der Mitmenschen, man solle »richtig Deutsch lernen«. Gorelik demonstriert, wie sehr solche Diskriminierungen Zuwanderer mental beschädigen können.
Sie zeigt eine vielen Einwandererkindern vertraute Rollenumkehr auf: »Wo unsere Eltern unbeholfene Kinder sind: auf dem Amt. Auf dem Arbeitsamt, dem Landratsamt, auf dem Ausländeramt, das vielleicht damals schon Ausländerbehörde hieß, aber das kann doch keiner aussprechen, der gerade aus Russlandukrainemoldawienweißrussland kommt: Behörde.«
TOPOS Der von Gorelik beschriebene, sich aus der mehrheitsdeutschen Lebensumwelt zurückziehende Vater ist schon fast ein Topos in der Literatur junger Autoren russischsprachiger Herkunft. Auch Dmitrij Kapitelman zeigt in seinen Büchern, was eingewanderte Eltern auf sich nehmen, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Beiden Autoren ist der kritisch-bilanzierende und gleichzeitig zärtlich-liebevolle Blick auf die Eltern und ihre Erfahrungen eigen.
Fast schmerzhaft ausführlich widmet sich Gorelik der ersten Zeit in Deutschland, die die elfjährige Lena mit ihrer Familie in einer Unterkunft für Asylsuchende verbringt. Holzbaracken hinter Stacheldrahtzaun, Familien auf engstem Raum, dünne Wände, Gemeinschaftsküchen und -duschen: Die Szenen lassen den Leser erschaudern. Es sind Monate, in denen die Ich-Erzählerin eine Scham für ihre Herkunft entwickelt, aber auch beginnt, die deutsche Sprache zu lernen, und erste Kontakte zu Deutschen knüpft.
In Wer wir sind zeichnet Gorelik Stück für Stück das bewegende und vielgestaltige Porträt einer Familie. Dabei geht sie über das Autobiografisch-Partikulare hinaus. Rund 30 Jahre nach dem Beginn der Einwanderung postsowjetischer Juden nach Deutschland hat Lena Gorelik den bisher umfassendsten, präzisesten und facettenreichsten literarischen Einblick in die Mentalität der jüdischen »Kontingentflüchtlinge« vorgelegt. Wer wissen möchte, wer sie sind, kommt an diesem Roman nicht vorbei.
Lena Gorelik: »Wer wir sind«. Rowohlt, Berlin 2021, 320 S., 22 €