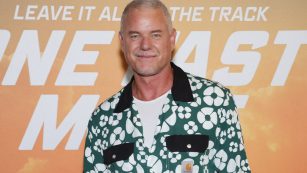Wir schreiben das Jahr 2019 – Deutschland in der nahen Zukunft. Die ewige Regierungschefin Hedwig Kleinert hat abgewirtschaftet. Zwar rettet sie in den Bundestagswahlen ihre Konservativen noch auf Platz eins der Wählerstimmen, doch dahinter kommt mit viel Schwung schon die rechtspopulistische »Deutsch-Nationale Mehrheitspartei«.
Die Gruppierung mit ihrem neonazistischen Anführer Urban Hansen greift nach der Macht – und mit ihr deren ehrgeiziger hessischer Landesvorsitzender, Paul Levite. Als Quotenjude soll er der Partei einen republikanischen Anstrich geben. Levite, barocker Genussmensch und unsteter Geist, entdeckt unerwartet machiavellistische Züge an sich. Er putscht sich an die Spitze der Bewegung und wird schließlich Bundeskanzler, indem er ein Bündnis mit der DDR (Die Deutschen Realsozialisten) eingeht.
Nazi-Dreck »Levite hatte endlich eine Heimat gefunden. Jetzt waren ›seine Leute‹ die deutschnationalen Parteigenossen«, schreibt Seligmann über den Aufstieg Levites. »Er hatte den Nazi-Dreck ausgekehrt, jetzt war der Stall sauber. Es war sein Stall – voller Kühe, Ochsen, Bullen. Er war ihr Bauer. Sie wollten ihn. Solange er ihnen frisches Heu zum Fressen gab und sein leeres Polit-Stroh drosch. Erstmals in seinem Leben fühlte Paul Levite, dass er ein Zuhause besaß. So nahe hatte er sich dem Judentum nie gefühlt. Levite war entschlossen, sein neues Ich vollständig zu erobern und zu verteidigen. ›Kommt mit mir, Leute‹, rief er. ›Folgt mir, damit wir gemeinsam Deutschland erobern‹.«
Rafael Seligmann, gewiefter Satiriker einerseits und gefragter Politberater andererseits, erzählt eine Parabel von der Macht und ihren Versuchungen, von Hybris und Selbstzweifeln und auch von den Brechungen einer jüdischen Identität im selbstgefälligen Deutschland der Gegenwart. Fantasienamen für all die Merkels, Höckes, Gaucks und Wagenknechts, für die Linke und die AfD scheinen nur ausgewählt, um dem Buch die eine oder andere Unterlassungsklage zu ersparen.
Denn egal, ob man Deutsch meschugge als Satire oder als düstere Projektion deutet, die Handlung ist – bis auf das etwas zu kulminierte Ende – so frappant realistisch, dass während des Lesens ein Blick auf das eine oder andere Nachrichtenportal Entspannung verschafft: Nein, Merkel ist noch nicht Kleinert, der Präsident heißt Steinmeier, und die AfD steht bei 6,5 Prozent …
islamisten Seligmanns Fiktion segelt hart am Wind der Fakten. Wobei die Tatsache, dass die AfD vermehrt um Juden buhlt, dem Autor nach eigener Auskunft neu war. Wie auch der Sachverhalt, dass die Rechtsausleger die berechtigte Angst vieler Juden vor islamistischen Radikalen genauso schamlos ausbeuten wie ihre jüdischen Mitglieder, die als demokratisches Feigenblättchen die teils offen neonazistischen Strukturen verhängen sollen. Auch, dass es den einen oder anderen »Paul Levite« in der AfD schon gibt, war Seligmann nicht bekannt.
Also hat ihn die Realität hier schon eingeholt – wenngleich die literarische Stärke des Buches vor allem in der fein durchbrochenen Schilderung des Menschen Levite liegt, eines selbstzweifelnden Polterers, der eigentlich von allen geliebt werden möchte und auch selbst alle liebt. Vor allem allen Frauen, wenn auch nur erotisch. Und weil er den Rausch der ersten Verliebtheit niemals verlieren möchte, wechselt er die Damen, bevor sich nur ein Ansatz von Routine entwickeln kann.
»Stets war er bereit gewesen, alles für die Liebe hinzugeben. Das ermöglichte ihm, ja zwang ihn geradezu zu stets neuen Liebesgeschichten – denen unweigerlich oft schmerzhafte Trennungen folgten«, heißt es über sein Liebesleben. »Als Levite seinen 40. Geburtstag durch eigene ›Schuld‹ einsam begehen musste, nahm er sich vor, fortan sein Liebesleben dem Verstand zu unterwerfen, sonst würde er als Hagestolz enden. Doch Levites Sinne setzten sich über diese Vernunftentscheidung mühelos hinweg. Sein Vater Herschl hatte seinen einzigen Sohn vor den Langzeitfolgen gewarnt: ›Ein junger Galan wird begehrt, ein alter Schmock ist verjährt‹.«
Selbstmitleid Diese private Unstetheit, die Seligmann mit spitzer Feder an den Rändern jüdischen Selbstmitleids entlang- und vorbeiführt, hat natürlich mit den Erlebnissen der Schoa zu tun, aus der sich auch Levites einziges moralisches Motiv speist: nie wieder wehrlos zu sein.
Die sensible Schilderung dieses so vielschichtig verstörten Helden ist für das Buch mindestens so wichtig wie die implizite politische Mahnung des Autors, die Demokratie im Lande sei nur ein dünner Firnis. Wer Deutsch meschugge liest, wird um diese Erkenntnis nicht herumkommen – schon allein deshalb nicht, weil manches unnötig dick aufgetragen wird. Wieso bei der Rechtspartei permanent von Gauen und Reichsvorstand die Rede ist, erschließt sich überhaupt nicht, da die Strukturen ansonsten gänzlich unberührt bundesdeutsche sind. Da sind dem Lektor einige überflüssige Nazi-Arabesken durchgerutscht. Sie allerdings trüben das Leseerlebnis kaum. Das könnte wohl nur die Realität, so sie denn das Buch überholen sollte.
Rafael Seligmann: »Deutsch meschugge«. Transit, Berlin 2017, 288 S., 24 €