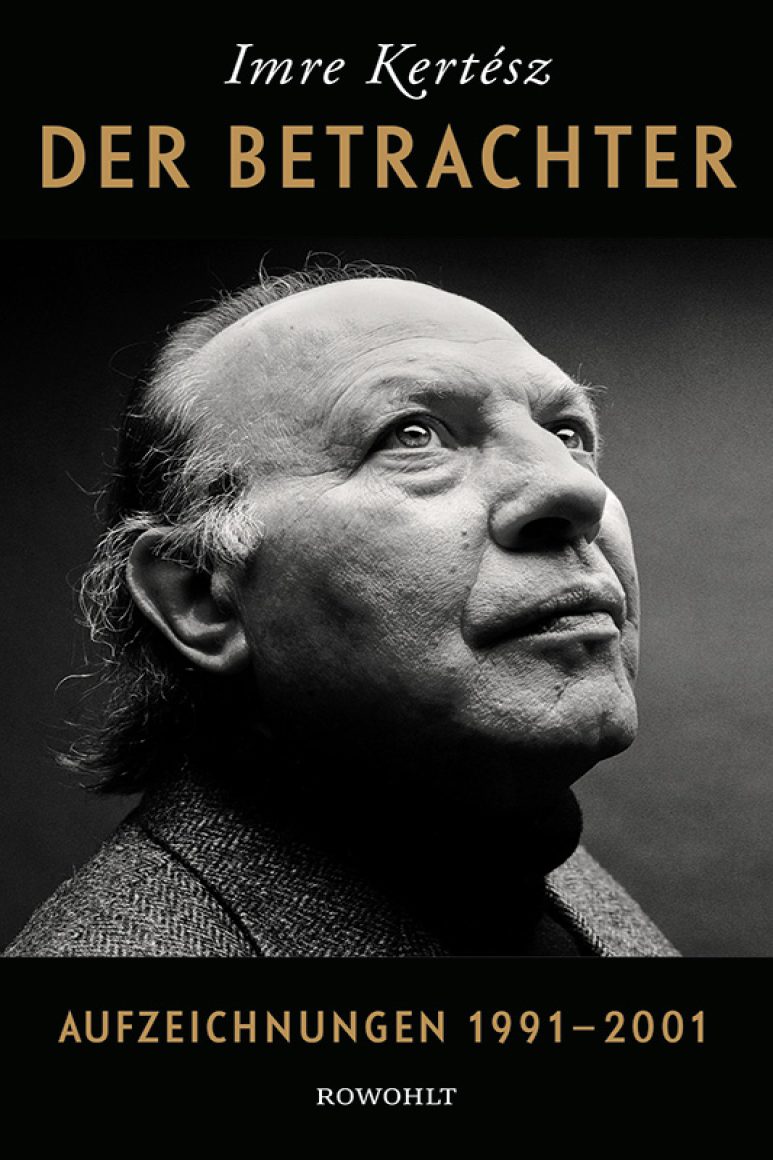Als »sensibel und durchaus gebildet« beschreibt Imre Kertész die Frau, die 1993 im ungarischen Miskolc vor Zuhörern seinen Roman Kaddisch für ein nicht geborenes Kind interpretiert.
Dass aber der Erzähler im Buch in Auschwitz gewesen ist, fehlt in ihren Ausführungen einfach. Nicht aus Scham. »Diese kluge, intellektuelle, etwa 35-jährige Frau wusste ganz einfach nicht, was Auschwitz in der europäischen Mythologie bedeutet (um jetzt von der Wirklichkeit gar nicht zu reden)«, schreibt Kertész. »Sie war sich nicht darüber im Klaren, was für Vorstellungen die heutige Zivilisation mit diesem Begriff verbindet.«
Die 40 Jahre währende »Schande der Ära Kádár und der um nichts weniger schändliche restaurative Geist der letzten drei Jahre« hätten den Holocaust schlicht aus dem allgemeinen Bewusstsein der ungarischen Intelligenz vertrieben. Ganz zu schweigen vom geschichtlichen Verantwortungsgefühl. Was aber, so fragt Imre Kertész, ist der gesamte europäische Bildungskanon wert, von Sokrates bis Kafka, Thomas von Aquin bis Heidegger, ohne den »Rauchschatten des Holocaust«, der das Gesetz am Leben erhalte? Wie lasse sich in einem Land leben, in dem die Menschen nichts von Auschwitz wissen?
exil Das Verhältnis zu Ungarn spielt eine große Rolle in Imre Kertész’ Aufzeichnungen der Jahre 1991 bis 2001, die unter dem Titel Der Betrachter jetzt postum erschienen sind. Bis kurz vor seinem Tod im März dieses Jahres arbeitete der Schriftsteller am Manuskript. Weil er nicht mehr die Kraft hatte, einen Roman zu schreiben, verwaltete er seine Notizen und brachte sie in eine literarische Form. Das Buch schließt so die Lücke zwischen dem 1992 erschienenen Galeerentagebuch und dem Band Letzte Einkehr (2013), sodass nunmehr eine mehr als 1000-seitige Trilogie vorliegt, die rund 50 Lebensjahre umfasst.
Die Atmosphäre im Land empfindet Kertész als unerträglich. Das Wiederaufkommen des Faschismus, das er mit Grauen verfolgt, erinnert ihn an das Budapest seiner Kindheit. Schon 1991 spielt er mit dem Gedanken, Ungarn zu verlassen: »Man kann die Freiheit nicht an dem Ort erleben, wo man die Gefangenschaft erlebt hat. Man sollte fortgehen, weit fort.« Dazu aber müsse er neu geboren werden.
Noch ist das Exil für ihn unvorstellbar – auch wenn er mit Erschrecken feststellt, »dass die entscheidende Mehrheit der Intellektuellen« im Land offenbar die ideologische Diktatur will, weil sie die neu gewonnene Freiheit nach dem Ende des Kalten Krieges nur als Unsicherheit empfindet. »Grauenvolles Erleben von Fremdheit, seit Wochen«, notiert Kertész. »In einem feindlichen Land, aber dieses Land ist aller Feind, am meisten sein eigener; unsäglich fremd; unaufhörliches Flüchten, Sichtarnen, Sichverstecken, Angst; alles ist düster und bedrohlich – sollte das das jüdische Gefühl sein?«
»Juden-Komplex« Immer wieder setzt Kertész sich auch mit seinem Glauben auseinander, bricht das Leben als Jude an den Schriften von Kafka, Camus und Wittgenstein – über dessen »Juden-Komplex« er schmunzeln muss (»jedes wirkliche oder vermeintliche Negativum, das er an sich selbst entdeckt, nennt er jüdisch«).
Mit Ekel verfolgt er, der als Kind Auschwitz und Buchenwald überlebt hat, die Neugründung der antisemitischen Pfeilkreuzlerpartei; oder schaut zu, wenn in der Budapester U-Bahn ein Prolet über einen »Hakennasigen« schimpft, der sich vorgedrängelt habe. »Wie viele Erfahrungen sind noch nötig«, fragt Kertész, »bis alle Juden von hier verschwinden und diesem Land Farbe, Spannung und restliche Interessantheit nehmen, dem Land, dem sie so viel von ihrem Talent gespendet haben und das kein anderes Gefühl außer mörderischen Affekten ihnen gegenüber hegt?«
Die Aufzeichnungen, in denen er seine »Budapester Depression« beschreibt, wie er sie nennt, sind nicht leicht zu lesen. Sie erinnern an Aphorismen, sind philosophischer als die späteren in Berlin entstandenen Tagebücher seiner Letzten Einkehr. Deutlich wird, dass es dem Autor gesundheitlich noch besser geht, der körperliche Verfall, die Parkinson-Erkrankung seine Existenz nicht in dem Maß dominieren wie später dann nach der Verleihung des Literaturnobelpreises im Jahr 2002.
Holocaust Die Themen der letzten Jahre klingen zwar schon an: etwa wenn Kertész Angst hat, immer mehr in die Rolle des jüdischen Schriftstellers hineinzugleiten, vereinnahmt zu werden als Überlebender des Holocaust. »Ich fürchte, eine museale Panoptikumsfigur zu werden, die man von Zeit zu Zeit in den Zug oder ins Flugzeug packt.« Oder wenn er daran denkt, als Schriftsteller zu versagen. »Kreativitätsmangel ist insofern schlimmer als der Tod, als man ihn lebendig ertragen muss.« Aber Selbstzweifel und Depressionen haben ihn noch nicht ganz im Griff.
Selbst dann nicht, als seine Frau Albina stirbt, mit der er 42 Jahre verheiratet war. »Die große Zäsur meines Lebens. Das Grauen meines Lebens. Hier steht alles still. Ob es jemals weitergeht?«, schreibt er am 1. August 1995, nachdem sie kollabiert ist. Am Abend zuvor noch waren sie bei Magda zum Abendessen eingeladen, saßen unter Sternen auf der Terrasse. »In einem halben Jahr werde ich schon von dort oben, hinter den Schäfchenwolken hervor auf euch blicken …«, sagte Albina, als hätte sie eine Vorahnung gehabt.
Die Passagen, die von ihrem Tod erzählen, gehören zu den verstörendsten im Buch. Immer wieder gibt sich Kertész die Schuld, nicht für sie da gewesen zu sein. »Die Aufgabe, die sie auf sich nahm (mein Glück auf Erden), hat sie vollkommen erfüllt, und an dieser Vollkommenheit geht sie zugrunde. Ich, der ich alles hingenommen und nichts dafür geleistet habe, bin, wie so oft, (noch) am Leben.« Selbst am Ende im Krankenbett noch drückte sich ihre Fürsorge aus in der Frage, wie er nach ihrem Tod schreiben wolle.
Und er? Nicht nur, dass ihm schon am Sterbebett der »niederträchtige« Gedanke kommt, sie »zu verewigen«, was er mit Ich – ein anderer (1997) tut. Nein, er fühlt nach ihrem Tod sogar eine gewisse Befreiung. Ein Jahr später heiratet er Magda Sass und geht 2001 mit ihr nach Berlin, wo man ihm ungleich mehr Wertschätzung entgegenbringt als in Ungarn. »Eigentlich habe ich nirgends so viel Liebe bekommen wie in Deutschland, wo man mich ermorden wollte.«
Imre Kertész: »Der Betrachter. Aufzeichnungen 1991–2001«, Übersetzt von Lacy Kornitzer und Heike Flemming. Rowohlt, Reinbek 2016, 256 S., 19,95 €