Lächeln statt weinen
Der Buchtitel Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten ist lang, sehr lang. Gleichzeitig ist es die kürzeste Inhaltsangabe für ein literarisches Requiem auf die österreichische k. u. k. Kultur und ihren spezifisch jüdischen Anteil. Der Schöpfer des Sammelbandes mit 16 Kapiteln und einem fünfteiligen Anhang, Friedrich Torberg (1908–1979), warnt im Geleitwort, es sei ein »Buch der Wehmut«. Nicht so sehr wegen der Erinnerungen an Prager und Wiener Kaffeehausgänger und Käuze, Oberkellner und Originale, jüdisches Bürgertum und extravagante Bohème, die von einer schnelllebigen Zeit überholt und aus dem Weg gekickt wurden. Nicht wegen eines Abendlandes, das in seiner christlich-jüdischen Ausprägung bis heute beschworen als untergegangen zu betrachten ist. Sondern – Anekdoten hin, Geschichten her – schlicht und einfach fast völlig ausgelöscht wurde.
Wer sich das ehrlich eingesteht, die Krokodilstränen abwischt und auf den Alltag und die Animositäten von Literaten, Luftmenschen und Lebenskünstlern einlässt, von Alfred Adler und Anton Kuh bis Alfred Polgar und der unvergleichlichen Tante Jolesch, wird belohnt mit tiefgründigem Humor, Lebensweisheiten und der Torbergschen These, »dass in unserer technokratischen Welt, in unserer materialistischen Kommerz- und Konsumgesellschaft die Käuze und Originale aussterben müssen«.
Dieser Gedanke – wie die ganze 1976 erstmals erschienene Sammlung – ist von bestechender Aktualität. Der Anekdotensammler Torberg wie auch die Leserschaft jeder Generation weiß etwas, was die Menschen des ausgehenden 19. Jahrhunderts bis in die Zeit des Anschlusses Österreichs hinein nicht ahnten: dass diese Welt auf einen gewaltsamen Untergang zusteuerte. Und trotzdem: Torbergs Buch ist eine wunderbare Lektüre für jede Jahreszeit. Er wollte kein »Buch der Trauer« schreiben, die wollte er lieber mit sich allein abmachen. Er setzte auf etwas viel Stärkeres: »Wehmut kann lächeln, Trauer kann es nicht. Und Lächeln ist das Erbteil meines Stammes.«
Ellen Presser
Friedrich Torberg: »Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten«. Langen-Müller, München 2013, 656 S., 18 €

Figurenensemble des Dritten Reiches
Fluchtgeschichten sind ein herausragendes Thema in Anna Seghers’ literarischem Werk. Unabhängig davon, wer verfolgt wird, sind sie stets spannend. Das gilt auch für Seghers’ Welterfolg Das siebte Kreuz, den sie in Frankreich auf der Flucht vor den Nazis geschrieben hat. Der Roman erzählt die Geschichte von Georg Heisler, der als einziger von sieben aus einem deutschen KZ geflohenen Häftlingen davonkommt. Seghers bedient sich dabei keiner Schwarz-Weiß-Malerei, die den bösen Nazis die guten Helfer des Kommunisten Heisler gegenüberstellt.
Vielmehr entwirft sie ein vielschichtiges, authentisches Bild der damaligen deutschen Gesellschaft. Es gehört zu den Stärken dieses Buches, dass Seghers dabei keine ihrer Figuren verrät, indem sie sie der Verachtung preisgibt. Sie versucht vielmehr, in jeder Figur den Menschen zu sehen. Das wird an einer der letzten Szenen deutlich, dem gemeinsamen Apfelkuchen-Sonntag bei der Familie Marnet. Hier ist ein »ganzes Volk« versammelt, das Figurenensemble des Dritten Reiches. Eingebettet ist diese Szene in die Landschaft des Taunus mit ihrer Nähe zum Rhein. Bei keinem Dichter und keiner Dichterin der 30er- und 40er-Jahre ist deutsche Landschaft so eindringlich in ihrer historischen Bedeutung als kulturelle Region, die bis auf die Römerzeit zurückgeht, sowie in ihrem Sehnsuchtspotenzial als Heimat literarisch vergegenwärtigt wie bei Anna Seghers.
Viele Gestalten in Das siebte Kreuz sind unvergesslich. Der unbekümmerte Schäfer Ernst ist die einzige politisch neutrale Figur des Buches. Trotzdem wirft er sein Halstuch »wie ein Feldzeichen« in die Landschaft, um zu zeigen, dass auch er zu ihr und in diese Zeit gehört. Bei anderen Figuren hat Seghers bis ins Physiognomische hinein die furchtbare Zeit des Dritten Reiches gezeichnet. Der Mann, dem Heisler auf dem Schiff, das ihn nach Holland bringen wird, begegnet, hat »ein Gesicht, hinter dem man gar nichts Gutes vermutete, eben darum für diese Zeit das rechte Gesicht für einen aufrechten Mann«.
Daniel Hoffmann
Anna Seghers: »Das siebte Kreuz«. Aufbau, Berlin 2015, 448 S., 20 €

Blut, Schweiß und Brot
Es lohnt sich, Meir Shalevs fulminanten Roman über eine Bäckerfamilie und ihre Geschichte erneut in die Hand zu nehmen.
Am 12. Juli 1927, am Tag vor dem großen Erdbeben in Jerusalem, durchquert eine Kutsche das Jaffator zur Altstadt. Gezogen wird sie von einer stämmigen blonden Frau; in dem Gefährt selbst befinden sich der gefesselte und geknebelte Ehemann und Bäckergeselle Abraham Levi sowie ihre beiden Söhne. So schräg bereits beginnt die faszinierende Familiensaga des israelischen Autors Meir Shalev.
Bald schon gründen die Levis in einem Dorf nahe Jerusalem eine Backstube. Dort prallen die unterschiedlichsten Welten und Generationen aufeinander: der halbblinde Erzähler Esau, sein Bruder Jakob, mit dem er sich eine Brille teilen muss, weil Vater Abraham der Überzeugung war, dass ein Paar Augengläser für beide Söhne reichen muss, ihre russische, zum Judentum konvertierte Mutter sowie der sefardische Clan des Vaters. Neueinwanderer aus Deutschland und Polen runden den Shalev’schen Kosmos ab. So entsteht ein literarisches Mosaik, das viel über das Leben im Palästina der britischen Mandatszeit und des jungen Staates Israel verrät.
Im Mittelpunkt steht immer wieder das bunte Treiben rund um die Backstube der Levis, die bald im Ruf stehen, ein ganz besonderes Brot herzustellen. Der Leser nimmt Anteil an dieser bunt gemischten Dorfgemeinschaft und ihren bis ins Groteske gesteigerten Schwächen und Stärken. Mit seinem nach Ein russischer Roman zweiten Erfolgswerk belegte Shalev einmal mehr die Qualität der damals noch recht jungen israelischen Literatur. Dabei erwies er sich als feinfühliger Kosmopolit, als ein Autor, der als Israeli im wahrsten Sinne des Wortes in der Weltliteratur zu Hause ist. Seine Familienchronik ist eine spannende und ironische Erzählung voller Mythen, Legenden und Rätsel, seine Sprache zeigt sich geprägt von alttestamentarischer Klugheit und stilistischer Modernität.
Ralf Balke
Meir Shalev: »Esaus Kuss«. Diogenes, Zürich 1996, 512 S., 14 €
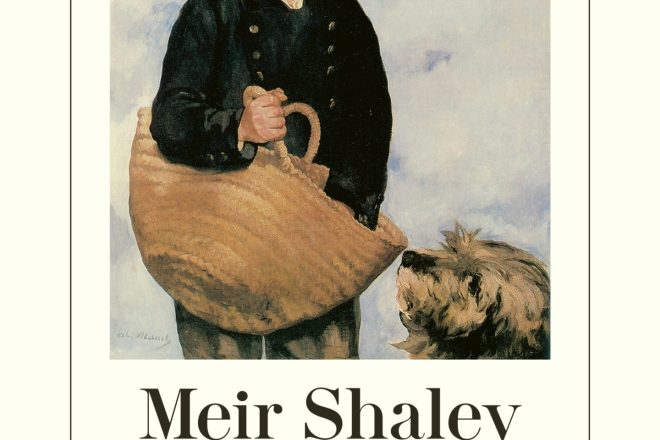
Der ungeübte Selbstmörder
Eigentlich handelt es sich bei den 110 Seiten um eine Teilbiografie. Sie beginnt im Jahr 1906 mit dem Umzug John Höxters von Hannover nach Berlin und endet mit dessen Suizid mehr als 30 Jahre später. Für den Biografen Jörg Aufenanger ist der Fokus auf Teilaspekte eines Lebens eher die Regel als die Ausnahme. Er schrieb schon über Heinrich Heine in Paris, Vierzig Tage im Leben des Heinrich von Kleist oder über Schiller und die zwei Schwestern. Nun also ist John Höxter in sein Blickfeld geraten, dessen Name weit weniger bekannt ist als der von Heine, Kleist oder Schiller.
John Höxter ist 22 Jahre alt, als er in Berlin auftaucht. Er möchte Künstler werden. Sein Vater, der erfolgreiche Kaufmann Samuel Höxter, finanziert ihm ein Studium bei dem arrivierten Maler Leo von König. Bald schon ist der Filius weniger im Atelier als in Berlins Kaffeehäusern anzutreffen. »Er kannte jeden und ein Jeder kannte ihn, doch wer kannte ihn wirklich?« – so beginnt Aufenanger sein Buch, dem ein bienenfleißiges Quellenstudium vorausging. Er war bei Herwarth Walden fündig geworden, jenem jüdischen Multitalent, der Höxter als »Epigonen und Kitschier« verspottet.
Womöglich spielt er auf die holzschnittartigen Porträts an, die Höxter von manchem Zeitgenossen anfertigte. Auch dessen expressionistisch anmutende Lyrik, die in einem von Höxter selbst verlegten Bändchen abgedruckt wird, stellt der Biograf vor. Und in Else Lasker-Schüler erkennt Aufenanger eine Seelenverwandte Höxters, die noch aus dem Exil zu ihm brieflichen Kontakt suchen wird.
Höxter kann sich die Emigration nicht leisten. Sechs Tage nach der Pogromnacht im November 1938 schreibt er einen eindrucksvollen Abschiedsbrief an seinen einstigen Kunstlehrer Leo von König. An dessen Ende heißt es in tragisch-jüdischer Selbstironie: »Halten Sie der Situation zu Gute, wenn ich etwas wirr und unklar schreibe. Ich bin noch ein ungeübter Selbstmörder.« In einem Wald bei Potsdam setzt John Höxter seinem Leben ein Ende.
Gerhard Haase-Hindenberg
Jörg Aufenanger: »John Höxter – Poet, Maler und Schnorrer der Berliner Bohème«. Quintus, Berlin 2016, 112 S., 16 €
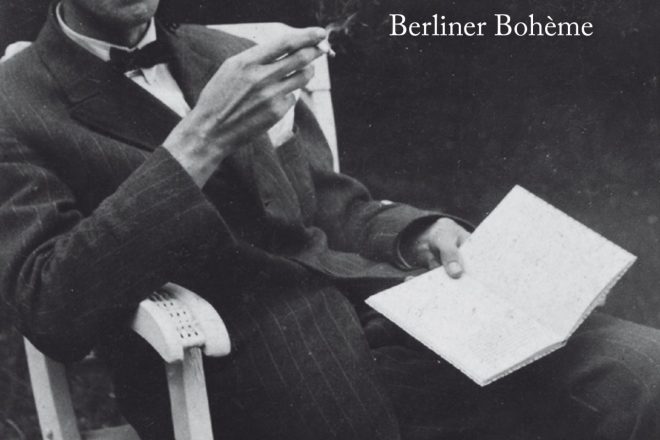
Lust auf noch mehr Tipps? Herkunft, Seelen, wilde Ehen oder Narnia, Kinder, Black Lives Matter









