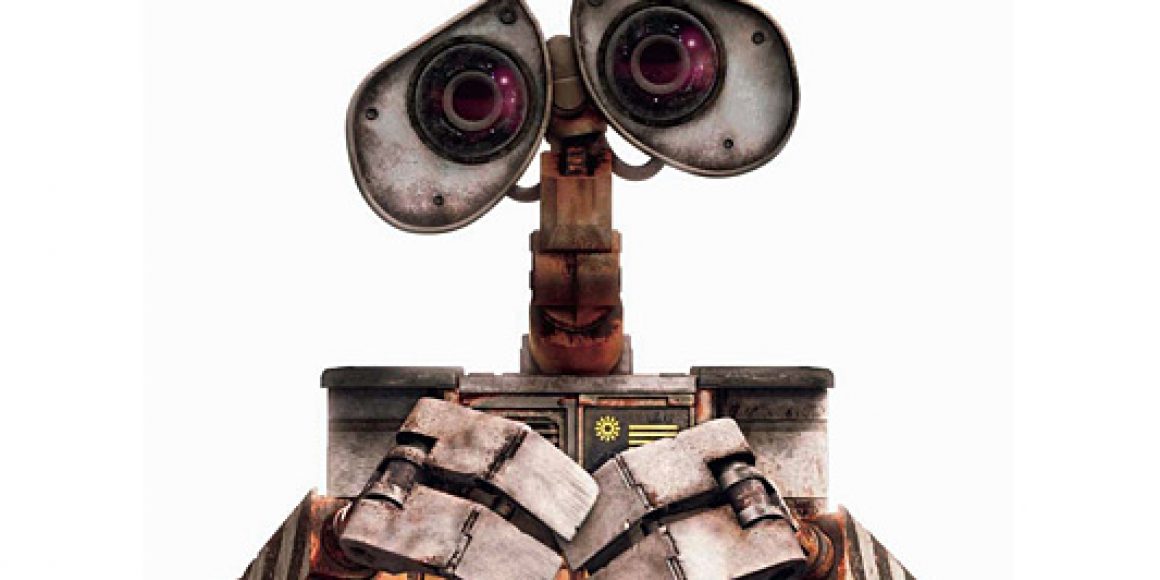Menschen lernen aus Fehlern, zumindest im Idealfall. Man erinnert sich daran, etwas falsch gemacht zu haben, und entscheidet sich beim nächsten Mal für eine andere, bessere Variante. Auch Computer erinnern sich. In modernen Webbrowsern gibt es beispielsweise Übersichten über die Seiten, die der Benutzer am häufigsten besucht hat. Das Textverarbeitungsprogramm weiß, welche Dokumente zuletzt bearbeitet wurden, und Windows stellt die am häufigsten aus dem Startmenü aufgerufenen Programme gleich übersichtlich zur Verfügung.
Doch das »Wissen« um die Vergangenheit ist auch bei Computern nicht das gleiche, wie die Fähigkeit, aus ihr zu lernen. Bei den genannten Beispielen geht es einfach nur um simple Zahlenwerte und Statistiken – darüber, wie häufig etwas getan wurde oder was zuletzt passiert ist.
Am Beispiel der am häufigsten besuchten Webseiten lässt sich das besonders einfach zeigen. Schnell ist in eine solche Liste mal eine Seite gerutscht, bei der man sich nur in der Adresse vertippt hatte – einfach, weil gewisse Buchstabendreher häufig vorkommen. Oder man hat eine Seite, die einen Newsticker enthält, der alle zehn Sekunden automatisch neu abgerufen wird, nur für eine Stunde offen gelassen – und schon hat man eine neue am häufigsten besuchte Webseite, die man vielleicht aber nie mehr aufsuchen will.
In solchen Situationen wünscht man sich, dem Computer einfach sagen zu können, dass das, was er da gerade veranstaltet, ziemlich unnütz ist. Wie schön wäre es, wenn sich der Computer dafür entschuldigen würde, vielleicht ein kleines bisschen bedrückt wäre und sich vor allem in Zukunft in einer vergleichbaren Situation nicht mehr so dämlich anstellte.
datenstau An der Universität von Tel Aviv wurde nun ein neues Projekt unter der Leitung von Yishay Mansour und seinem Kollegen Noam Nisan von der Hebräischen Universität Jerusalem ins Leben gerufen. Mansour will mit einem 20-köpfigen Team Computern Bedauern beibringen – oder zumindest das, was dem für einen Computer am nächsten kommt. »Bedauern« in der Computerwelt definiert Mansour einfach als Lernen aus dem Abstand zwischen dem gewünschten und dem tatsächlichen Ergebnis. Am Beispiel der vorgeschlagenen Webseiten soll der Computer also erkennen, dass der Nutzer den Vorschlag entweder gar nicht annimmt oder schon ein paar Sekunden später eine andere Seite aufruft.
Ziel des Projekts ist derzeit allerdings noch nicht der Heimcomputer. Geforscht wird zunächst für Infrastruktursysteme – zum Beispiel, wie sich Engpässe beim Datenverkehr im Internet umgehen lassen. Für die Regelung der Datenströme und ihre Routen – also den Weg, den die einzelnen Datenpakete nehmen – sind Internetrouter zuständig. Entsteht nun an einer Stelle ein Engpass oder fällt eine Verbindung sogar ganz weg, so versuchen diese eine alternative Route zum Ziel des Datenpakets zu finden. Welche alternative Route sie dann verwenden, hängt von ihrer Programmierung ab. Bisher führte dies dazu, dass ein Engpass sehr oft gleich mehrere weitere Engpässe auslöste – und so in einer Kettenreaktion Staus in großen Teilen der Datenverkehrswege verursachen kann.
Die Gründe für einen solchen Stau sind vergleichbar mit denen eines Verkehrsstaus. Auch auf der Straße versuchen Menschen, bei verstopfter Hauptstraße durch Nebenstraßen voranzukommen. In der Folge steigt das Verkehrsaufkommen in den Nebenstraßen, wo bald auch nichts mehr geht – der Stau dehnt sich damit auch auf andere Straßen aus.
Mansour und Nisan betrachten Situationen wie diese aus dem Blickwinkel der Spieltheorie. Die Spieltheorie dient zur Erforschung von Entscheidungssituationen, bei denen sich mehrere Beteiligte gegenseitig beeinflussen. Sie entstammt eigentlich der Mathematik, findet aber inzwischen Anwendung in so unterschiedlichen Bereichen wie Soziologie, Rechtswissenschaft, Biologie und eben Informatik.
Und die spieltheoretische Analyse solcher Entscheidungssituationen haben Mansour und sein Team nun in einen Algorithmus übertragen, der es Routern ermöglichen soll, aus der Vergangenheit zu lernen – und so das nächste Mal eine Entscheidung treffen zu können, die keine ungewollten Konsequenzen hat.
werbung Finanziert wird das Projekt von Google. Der Internet-Riese hofft, diese Technologie einsetzen zu können, um dem Benutzer anhand seines Suchverhaltens noch besser als bisher auf die persönlichen Vorlieben abgestimmte Werbung präsentieren zu können. Denn solche wird häufiger angeklickt, und damit verdient Google eine Menge Geld. Doch auch für den Nutzer ist es eigentlich begrüßenswert – denn wenn schon Werbung, dann doch bitte lieber für ein Produkt, das auch von Interesse ist.
Zunächst klingen die Entwicklungsziele nicht so sehr danach, als ob der Computernutzer zu Hause davon wirklich profitieren würde – einmal abgesehen von einem für den Einzelnen kaum wahrnehmbaren schnelleren Internet und passenderer Werbung. Doch die Erfahrung aus der Vergangenheit lehrt, dass eine einmal entwickelte Computertechnik bald auch für andere Anwendungsfälle angepasst wird. Also wird sich in naher Zukunft auch der Heimcomputer an seinen Benutzer gewöhnen und aus der Erfahrung lernen. Das Problem dabei ist nur: Wenn man mal jemand anderen an sein eigenes Benutzerkonto lässt – wie verhindert man, dass derjenige dem Computer Unfug angewöhnt? Und wenn man sich einen neuen Computer leistet – kann man dann die gelernten Verbesserungen des alten irgendwie übernehmen? Es bleibt also noch genug zu erforschen.