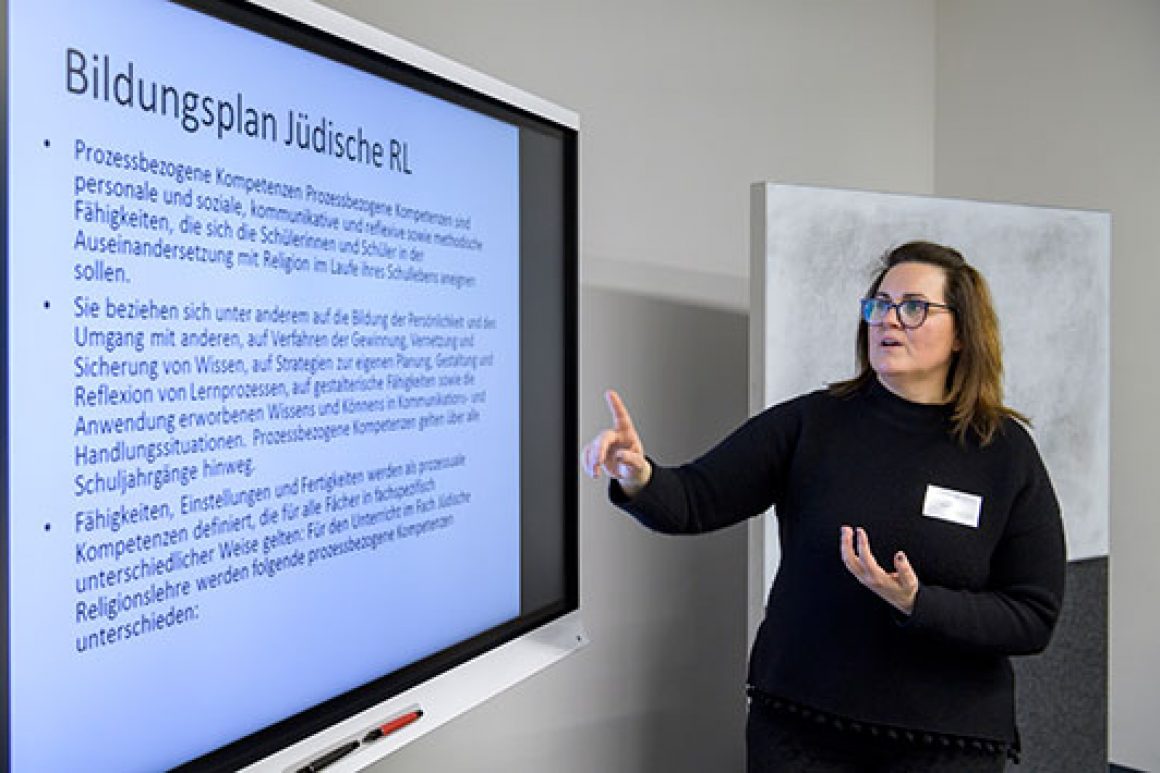Die Jugend ist unsere Zukunft.» Diesen Standardsatz der Hoffnung, aber auch der unterschwelligen Ängste, hört man oft in jüdischen Gemeinden in Deutschland. Wie diese Zukunft ausfällt, hängt zu einem beträchtlichen Teil von den Lehrerinnen und Lehrern ab, die jüdischen Religionsunterricht und Hebräisch in den Gemeinden, aber auch in öffentlichen und in den wenigen jüdischen Schulen im Land erteilen. Können sie Kinder und Jugendliche in ausreichender Zahl erreichen, um deren Jüdischsein zu entwickeln und sie so für die aktive Teilnahme am Gemeindeleben zu gewinnen?
Umso wichtiger ist ein Fortbildungsangebot für Religions- und Hebräischlehrer, das der Zentralrat in Kooperation mit der Zentralwohlfahrtsstelle (ZWST) etabliert hat. Die Fortbildung fand nun zum ersten Mal in der Hochschule für Jüdische Studien (HfJS) in Heidelberg statt – dort, wo die meisten Religionslehrinnen und -lehrer ihre Ausbildung absolviert haben. 80 Pädagogen aus ganz Deutschland waren gekommen, um sich von Sonntag bis Dienstag neue Anregungen zu holen – aber auch, um ihre Probleme zu thematisieren, mit denen sie im Alltag konfrontiert werden.
Synergien Aron Schuster, stellvertretender Direktor der ZWST, machte deutlich: «Die Hälfte unserer Gemeindemitglieder ist über 60 Jahre alt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir versuchen, viele der jungen Menschen, die wir noch haben, an unsere Gemeinden und unsere Religion heranzuführen.» Shila Erlbaum vom Zentralrat betonte, warum gerade Heidelberg ein idealer Ort für Lehrerfortbildungen ist: «Wir wollen Synergien schaffen.» An der HfJS können die pädagogischen Praktiker mit den Professoren in einen fruchtbaren Austausch treten, um auch Neues zu entwickeln.
Der Rektor der Hochschule, Johannes Heil, signalisierte bei seiner Begrüßung, von welcher enormen Bedeutung es für seine Einrichtung sei, im Miteinander zu neuen Wegen zu kommen. Es sei essenziell, dass in den Gemeinden junge Leute dazu ermuntert werden, ein Studium der jüdischen Religion aufzunehmen.
Zurzeit könne man mit den Absolventen bei Weitem nicht die Nachfrage decken. Er appellierte: «Wir müssen das Judentum speziell in den öffentlichen Schulen noch viel präsenter machen, als das bisher der Fall ist. Es muss deutlich werden, dass Judentum nichts Randständiges, sondern in der Mitte der Gesellschaft verankert ist, wie das Katholische und das Evangelische.»
Panorama Dieses Bemühen um Sichtbarkeit des Jüdischen machte Heil auch in seinem Fachvortrag über die Bedeutung der jüdischen Geschichte im Kontext der Allgemeingeschichte deutlich. Er plädierte dafür, das Panorama jüdischer Geschichte breit zu entfalten, nicht nur, aber auch im Religionsunterricht. Jüdische Geschichte dürfe im Unterricht aller Schulen nicht nur auf Hitler, Stalin und Pogrome verkürzt werden. Es gehe darum, jüdische Geschichte und Kultur in ihren europäischen, ja globalen Dimensionen zu vermitteln. Heil: «Ohne jüdische Geschichte ist keine Gesamtgeschichte vollständig.»
Hochschulrabbiner Shaul Friberg sorgte mit seinem emotional packenden Eröffnungsvortrag unter dem Titel «Auf in die Shul!» für ein besonderes Erlebnis bei dieser Fortbildung. «Was machen wir, damit sich Kinder und Jugendliche im Unterricht im Jüdischsein wohlfühlen?», fragte er provozierend. Es komme darauf an, dass sich Lehrende erst einmal selbst die Frage stellen: «Wer bin ich als Jude? Wer bin ich als Lehrer?»
Erst, wenn man sich selbst gegenüber ehrlich sei, könne man junge Menschen überzeugen. Man könne nicht die Herzen von Kindern gewinnen, wenn man lediglich eine Rolle spiele. Nur wer echt und authentisch sei, werde von ihnen auch ernst genommen. Fribergs Fazit: «Wir haben eine gute Arbeit gemacht, wenn wir den Schülern Wissen vermittelt haben, mit dem sie dann selbst entscheiden können, wie sie sich im jüdischen Leben positionieren.»
Empathie Mehrere Workshops und Vorträge widmeten sich dem aktuellen Thema des Umgangs mit Antisemitismus, Schoa und Nahostkonflikt. Die Lehrkräfte erleben, dass jüdische Schüler mit solchen Fragen sehr früh konfrontiert werden und stabile Antworten brauchen.
Esther Rachow von der International School for Holocaust Studies der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem ermunterte dazu, sich verstärkt des Materials zu bedienen, das ihre Institution gerade auch für den Unterricht im spezifisch jüdischen Lernkontext zur Verfügung stelle. Es gelte, der unkontrollierten Konfrontation mit der Holocaust-Thematik in der Gesellschaft, vor allem in Deutschland, pädagogisch-didaktische Konzepte entgegenzusetzen.
Das Ziel sei, nicht Abwehrmechanismen gegenüber der Erinnerung an den Holocaust zu entwickeln, sondern «distanzierte kognitive Empathie» herauszubilden.
Die Schule als Abbild der Gesellschaft. So ist es nicht verwunderlich, dass zum Teil auch gewalttätiger Antisemitismus zu Erfahrungen von Schülern, aber auch bereits von Lehrkräften geworden sind. Marina Chernivsky und Romana Wiegemann vom ZWST-Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment in Berlin stellten Interventions- und Beratungsstrategien vor, um dieser bedenklichen Entwicklung begegnen zu können.
Konflikte Johannes Becke, Juniorprofessor für Nahoststudien an der Heidelberger Hochschule, sieht junge jüdische Menschen in einem Konflikt. Einerseits sei der Staat Israel für sie eine natürliche Tatsache. Sie haben dort Verwandte, haben das Land schon besucht. Andererseits erleben sie die emotional aufgeheizte Debatte über den israelisch-arabischen Konflikt in Deutschland und eine oft einseitige Berichterstattung in den Medien.
In dieser Situation sei es wichtig, im Religionsunterricht, aber auch in Fächern wie Geschichte und Sozialkunde nicht nur die Besonderheiten dieser Auseinandersetzung zu behandeln, sondern darauf zu verweisen, dass es auch bei anderen Nationalstaatenbildungen ethnische Konflikte gegeben hat und gibt.
Becke schließt sich der Einschätzung der deutsch-israelischen Schulbuchkommission an: Es gibt ein deutliches Defizit in den Lehrbüchern. Sie seien fast nur auf Verfolgungsgeschichte, Schoa und den israelisch-arabischen Konflikt fokussiert. Der Nahostexperte sagt es deutlich: «Emotionaler Pro-Zionismus ersetzt nicht eine intellektuelle Auseinandersetzung.» Das Wissen über die Region und auch über das orientalische Judentum sei gering.