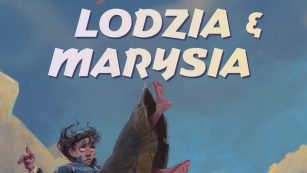Seine rechte Hand bleibt für die Länge eines Augenblicks in der Luft, von wo aus die linke eine Kurve nach unten zieht. So wie eine Welle bricht, so sanft, so kräftig und bestimmt, geht die Hand des Dirigenten nach unten. Dann beginnen die Bögen der Geiger von unten nach oben über die Saiten zu streichen, die Querflöte, die Fagotte, die Kontrabässe und das Klavier schicken die Musik, die vor fast 240 Jahren von Wolfgang Amadeus Mozart zu Papier gebracht wurde, durch den Saal der Berliner Philharmonie.
Wir sind im 23. Klavierkonzert von Mozart und mitten in einer musikalischen Reise durch die jüdische Welt, die vorbei an Peter Tschaikowskys Rokoko-Variationen für Cello, der Serenade für Streichorchester bis hin zu einem Medley und einem Lied von Naomi Shemer führen und der Philharmonie ganz neue Klangerlebnisse bescheren wird.
Gespielt wird diese Reise von den Berliner Symphonikern, interpretiert wird sie von vier international renommierten Musikerinnen und Musikern, die aus Israel, Kanada und Russland kommen und die jüdisch sind. Im Jahr 2024 kann alles das kompliziert sein, es kann aber auch Musik sein und gleichzeitig ein Spiegel von Kunst, Politik und Geschichte.
Arseniy Chubachin spielt Cello, seine Sprache ist die Musik.
Wie der von Sharon Azrieli, der kanadischen Kantorin, deren Augen sich mit Tränen füllen, wenn sie erzählt, wie sicher sie sich in Berlin fühle und wie sehr sie das gleichzeitig ein wenig schockiert, denn bis auf zwei Menschen wurde ihre gesamte Familie in der Schoa ermordet. Oder wie der des Pianisten Misha Shekhtman, dessen Eltern Wissenschaftler in Moskau sind und für die seit 2022 alles schwierig ist. Wie der des Cellisten Arseniy Chubachin, der diesen Abend mit den Berliner Symphonikern im Saal der Philharmonie veranstaltet und dessen Sprache, wie er sagt, die Musik ist.
Sprachlos vor Staunen
Er lebt diese Sprache und macht das Publikum damit sprachlos vor Staunen. Und nicht zuletzt die Geschichte von Samuel Gal Alterovich, dem international erfahrenen Dirigenten, der in seinem Namen Samuel das traditionelle und in Gal das neue Israel vereint. Gal, die Welle. Der Name kam irgendwann über ihn und gehört seitdem zu ihm.
Samuel Gal Alterovich, der in der Philharmonie zwar keinen Taktstock, aber einen Frack trägt, sitzt am vergangenen Freitagmittag in einem Park in Berlin. Ein Dirigent sei heute etwas freier in seinen Entscheidungen. Auch in solchen Fragen, was er zum Konzert trage: einen normalen Anzug, den klassischen Frack, ein schwarzes Poloshirt – alles das stehe weniger im Zentrum, seitdem Dirigenten die Ära der tyrannischen Bosse hinter sich gelassen hätten.
Führungsqualitäten klingen heutzutage anders, der Taktstock als Verlängerung der Hand hat immer häufiger ausgedient. Um mit einem Orchester zu kommunizieren, sagt Alterovich, habe er sich entschieden, einfach seine Hände zu benutzen. Mit ihnen zieht er die Musik in die Richtungen, durch sie gibt er Impulse und die Zeit. Musik in ihrer horizontalen und vertikalen Dimension zu erfassen und sie so zu steuern, dass sie weiterfließt, das geschehe bei Konzerten.
Am Montagabend im großen Saal der Philharmonie jedenfalls fließt sie; die Berliner Symphoniker und Samuel Gal Alterovich sind ein musikalisches Meer. Wie und ob das gelingt, beschreibt er am Freitag, entscheide sich manchmal innerhalb von wenigen Minuten bei der ersten Probe. Man müsse einander fühlen. Zeit dazu bleibt wenig, aber die wird intensiv genutzt.
Proben in der Kulturkirche Nikodemus
Wie am Sonntagnachmittag bei einer der Proben in der Kulturkirche Nikodemus. Die Kirche steht im Reuterkiez, nur zehn Laufminuten vom U-Bahnhof Hermannplatz entfernt. Die Cafés mit Flat Whites und veganen Scones neben Läden mit propalästinensischen Drucken, ein »Fuck Netanyahu« ruht sich brüllend an einer Häuserwand aus, eine palästinensische Flagge klebt am U-Bahnhof. In diesem politischen Spannungsfeld sitzen Solisten und Orchestermitglieder auf einem wasserblauen Teppich und proben, probieren, wiederholen.
Misha Shekhtman hat sein Stück soeben zu Ende gespielt und geht in den Kirchenvorraum. Er trägt ein blaues T-Shirt und schwitzt, als wäre er gerade quer durch Neukölln gejoggt. Musik zu machen, das ist auch irgendwie Sport. Jetzt ist aber erst einmal eine Pause angesagt; hinsetzen, die Beine ausstrecken. Shekhtman ist schlank und auch im Sitzen hochgewachsen, seine randlose Brille und die gelockten, dicken Haare verleihen dem jugendlichen Gesicht Reife und Ernsthaftigkeit. Dabei ist er eigentlich gerade etwas sauer, denn sein Koffer ist nicht mit ihm in Berlin gelandet. Aber das ist schnell vergessen, denn die Proben liefen gut.
»Es ist etwas ungewöhnlich, dass ich das Konzert als Solist mache, denn eigentlich bin ich Dirigent«, sagt Shekhtman. Das Konzert Nummer 23 ist für ihn so interessant, weil der zweite Satz schon fast romantisch klingt. »Dieser berühmte zweite Satz, der von so vielen Tänzern auf der ganzen Welt ausgewählt wird. Es gilt als ein sehr persönliches Stück Mozarts.«
Auch Mozart war ja nur ein Mensch
Es gebe aber kleine Fehler in den Manuskripten, auch Mozart war ja nur ein Mensch, der nebenbei noch Figaros Hochzeit schrieb, lacht Misha und singt den Fehler gleich direkt vor. »Es hätte so sein sollen, tadatatadat … und nicht so«, und singt weiter. Und dann wäre da noch diese Kadenz am Ende des letzten Satzes. »Ich habe da mal etwas komponiert«, sagt er mit einer Stimme, die nach Scherz und Wagnis klingt. Mozart mit Popmusik, mit einem Link zu Beethovens »Siebter«? »Ich habe es gestern mal ausprobiert – es war, nun ja, das Orchester war sehr ruhig«, lacht Misha, der sich mit seinen jungen 35 Jahren als »Dinosaurier« beschreibt.
Seine Mutter kommt aus einer jüdischen Familie, die ihre Wurzeln in der Ukraine hatte und dann nach Moskau zog. Sein Vater hat belarussische Vorfahren. Beide leben in Moskau, haben die israelische Staatsbürgerschaft. »2022 hatte ich fast mein eigenes Festival, aber dann kam alles anders«, sagt Shekhtman betrübt. Musiker müssten frei von Politik sein, »Musiker sind fliegende Vögel. Wenn man innerlich nicht frei ist, dann kann man nichts machen«. Auch ein Orchester sollte frei sein, offen, denn nur dann, bringt es Shekhtman auf den Punkt, könne es den »Surround Sound« geben, den sich ein Dirigent wünscht.
Vor dem Auftritt die Hände in Form bringen, das ist unerlässlich.
Mit den Berliner Symphonikern und Alterovich als Dirigenten gibt es diese Freiheit und Leichtigkeit, dieses Einende durch die Musik, das auch das Publikum im großen Saal der Philharmonie spürt. Es bedarf eigentlich keiner Worte, aber Alterovich sagt sie trotzdem. Dass das Konzert geplant wurde, bevor es zwei Zäsuren gab. Die der Pandemie und die des Krieges.
Musik wolle sich über das Trennende hinwegsetzen und Menschen zusammenbringen. Wie bitter nötig das ist, das weiß das Publikum und applaudiert nach der kurzen Ansprache. Zuvor hatte es Arseniy Chubachin gefeiert, den Cellisten, der sich am Ende von Tschaikowskys Rokoko-Variationen sein Instrument regelrecht vom Körper wegriss. Chubachin ist der Mann in Schwarz, ob bei der Probe oder beim Auftritt.
Seine Sprache ist die Musik
Er sagt nicht viel, denn seine Sprache ist die Musik. Die beherrscht der junge Musiker aus Russland perfekt. So perfekt, dass ihm selbst die Berliner Symphoniker nach der Probe Respekt zollten – mit dem Klopfen der Geigen- und Kontrabassbögen auf die Notenständer. Er, der leise Cellist, wirkt laut. Er bringt die Musiker zusammen. Es ist nicht sein erstes Konzert in der Philharmonie.
Wie er das schafft, was ihn antreibt, was ihn bewegt? Seine Musik beantwortet alle Fragen. Arseniy gibt alles – schon vor einem Auftritt. Schwimmer wärmen sich auf, indem sie mit den Armen rudern. Chubachin ist vor dem Spiel ein Schwimmer, einer, der Liegestütze macht, einer, der die Finger in Form bringt, der sein Instrument mit in einen Nebenraum nimmt und die sanfteste Melodie spielt. Der mit seinem schwarzen kleinen Handtuch sein Gesicht und sein Instrument trocknet.
»Er ist großartig«, sagt Sharon Azrieli über ihren Kollegen. Ihr gelingt am Montag das, was vielleicht selten in der Philharmonie zu hören ist, das Publikum mit einzubinden. »Wollt ihr mit mir singen?«, fragt die kanadische Kantorin die vielen Besucher, und die antworten mit einem überzeugendem »Ja«. Denn nach dem bekannten »Lʼamour est un oiseau rebelle« aus George Bizets Carmen nimmt Azrieli das Publikum an die Hand und singt »Avinu She-Ba-Shamayim«, gefolgt von einem Medley und dem Song, an dessen Ende es heißt »Ani Kinor« – »Ich bin eine Geige«, »Jeruschalajim Schel Zahav« von Naomi Shemer.
Spätestens jetzt wird klar, warum das Programm, das Alterovich als Schmelztiegel aus Alter und Neuer Musik bezeichnet, an diesem Abend so besonders ist. Azrieli nennt es »einzigartig« an einem bedeutenden Ort. Berlin, Deutschland.
Die Kantorin fühlt sich in Berlin sicher
Die Kantorin, die kürzlich in Amsterdam war und dort sogenannte propalästinensische Proteste sah, fühlt sich in Berlin sicher. Das überhaupt über die Lippen zu bringen, ist nicht einfach. Oft schaut sie dabei nach oben, um die Tränen nicht über das Gesicht laufen zu lassen, atmet tief ein, um der Stimme Halt zu geben. In Montreal, ihrer Heimatstadt, gäbe es so viel Antisemitismus, dass Berlin für sie ein sicherer Hafen sei. Das Publikum hat Azrieli umarmt.
So wie es die Berliner Symphoniker umarmt, Samuel Gal Alterovich mit einem langen Applaus beschenkt, Misha Shekhtman und Arseniy Chubachin würdigt. Sie stehen am späten Montagabend gemeinsam auf der Bühne und lassen sich vom Publikum tragen wie auf einer Welle. Einer ziemlich perfekten Welle in ansonsten stürmischer See.