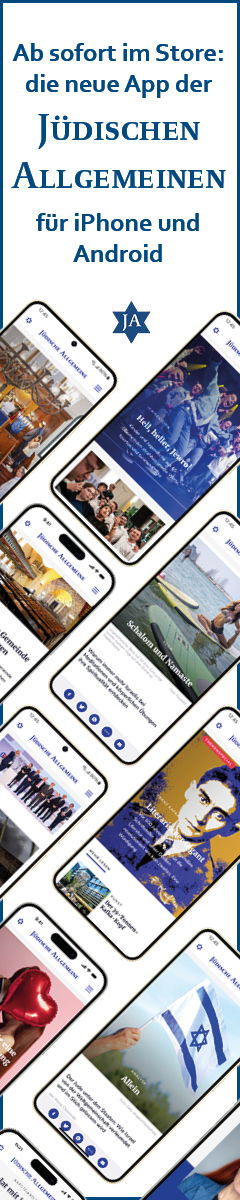Herr Kehlmann, Ihr Großvater war der mittlerweile in Vergessenheit geratene jüdische Schriftsteller Eduard Kehlmann, der in Wien die Schoa durch glückliche Umstände überlebte. Was wissen Sie über ihn?
Meine Großeltern väterlicherseits waren im Erwachsenenalter getaufte Juden. Das war zur damaligen Zeit üblich. Das bürgerliche assimilierte Judentum hatte sich nicht mehr viel aus seiner Religion gemacht. Die Taufe war – wie Heine es genannt hat – das gesellschaftliche Entreebillet. Einer der Glücksfälle, dem wir unser Überleben verdanken, war, dass ein Archiv, wo die Geburts- und Familienpapiere meines Großvaters aufbewahrt wurden, kurz vor der Nazizeit abgebrannt war. Deswegen musste man sich diese Pa-piere wieder ausstellen lassen, was er geschickt ausgenutzt hat, um sich durch neue Papiere zum »Halbjuden« zu machen, was er nach den Nürnberger Gesetzen natürlich keineswegs war. Meine Großmutter hat er zur »Halbjüdin« gemacht, indem er bestochene Zeugen aufgeführt hat, die bestätigt haben, dass sie nicht die Tochter meines Großvaters, sondern das illegitime Kind des Hausmeisters war. Man hat getan, was man konnte, um sich aus dem Gefahrenbereich zu bewegen. Nach dem Tod meines Vaters im Jahr 2005 gab es dann vieles, was sich über meine Familiengeschichte gar nicht mehr in Erfahrung bringen lässt. So etwas fragt man meist erst dann, wenn es schon zu spät ist.
Wie lebten Ihre Großeltern als »Halbjuden« nach dem Anschluss Österreichs?
Die Kriegsjahre waren für sie eine Zeit ungeheurer Armut. Mein Großvater war eigentlich Beamter in der Post- und Telegrafenverwaltung und hat dann im Zuge der Macht- übernahme der Nazis – da er »rassisch be-lastet« war – ohne staatliche Anstellung sich und die Familie durchbringen müssen und hat dann schließlich eine Firma gegründet, die einen bestimmten Baustoff herstellte. Das funktionierte aber überhaupt nicht, die Firma ging in Konkurs. Was mich wirklich sehr bewegt hat, war, als ich in der Bibliothek meines Großvaters eine Ausgabe von Joseph Roths »Radetzkymarsch« gefunden habe, die er Weihnachten 1942 aus dem Bestand seiner Bibliothek mit einer Widmung seiner Tochter geschenkt hat. Das heißt, sie hatten absolut gar nichts, sie konnten den Kindern keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Nach dem Krieg bekam mein Großvater dann einen Posten als leitender Beamter. All die Angst und Qual dieser Kriegsjahre sowie der ökonomische Druck blieben nicht ohne Wirkung. Er wurde herzkrank und ist schließlich 1955 gestorben.
Wie erinnerte sich Ihr Vater, der Regisseur Michael Kehlmann, an diese Zeit?
Mein Vater hatte Kontakte zur Widerstandsbewegung und ist auf einer Feier 1944 verhaftet worden, bei der sehr viele Leute aus der Widerstandsbewegung anwesend waren. Er kam dann nach Maria-Lanzendorf, in ein Nebenlager von Mauthausen. Vor dieser Zeit musste mein Vater die Schule verlassen. Als »Halbjude« durfte er nicht das Gymnasium besuchen, sodass er notgedrungen eine Lehre in einem Industriebetrieb absolvierte, wo man ihn aufgrund seiner Ungeschicktheit für einen Saboteur hielt. Maria-Lanzendorf war zwar kein Vernichtungslager, nach dem Krieg fand er jedoch heraus, dass seine Gefangenengruppe für den Transport nach Auschwitz vorgemerkt war. Es müssen im Lager entsetzliche Wochen gewesen sein. Mein Vater erzählte mir beispielsweise davon, wie er in diesem Lager mit den anderen Gefangenen in einer Reihe stand und der Kommandant am ersten Tag zu ihm sagte: »Ich sorge dafür, dass du hier nicht lebendig wieder rauskommst.« Im Chaos der letzten Kriegsmonate wollte sich dann ein Beamter aus der Verwaltung Gründe beschaffen, die er nach dem Krieg für seine Unschuld anführen konnte, und sorgte dafür, dass mein Vater freikam. Dieses Lager wurde auch regelmäßig bombardiert. Mein Vater hat mir immer wieder davon erzählt, wie er und die anderen Mithäftlinge während der Bombardements in den ungeschützten Baracken am Fenster standen und, um sich Mut zu machen, die »Internationale« sangen.
Hat Ihr Vater zu Hause viel über die Erfahrungen aus dieser Zeit gesprochen?
Mein Vater hat aus dieser Zeit nicht allzu viele Geschichten erzählt. Er hat sehr viel vom Leben in der Großfamilie erzählt. Familie war für mich immer das, das nicht da war. Außer meinen Großeltern, meinem Vater und einer Tante, die es nach England geschafft hatte, wurden alle abtransportiert, sind alle gestorben. Entfernte Verwandte, von denen wir erst spät erfahren haben, dass es sie noch gibt, leben in Israel. Für ihn prägend war sicherlich die Erfahrung, wie sich mit der Machtübernahme der Nazis das Verhalten der Menschen geändert hat und wie hämisch und böse der Antisemitismus in Österreich durchbrach. So hat beispielsweise der Nachbar, der vorher immer höflich gegrüßt hatte, regelmäßig über die Mauer am Haus meines Großvaters geschaut, sodass nur sein hässliches Gesicht zu sehen war und mit dunkler Stimme gerufen: »Juuud«. Da mein Vater einen Sinn für das Komische im Schrecklichen hatte, war für ihn dieses Erlebnis im Nachhinein aber auch ein sehr komisches Bild.
Täuscht mein Eindruck, oder haben Sie bisher die Geschichte Ihrer Familie in Gesprächen mit den Medien nicht thematisieren wollen?
Es war keine bewusste Entscheidung, darüber nicht zu sprechen. Das heißt: Dort, wo ich von meiner Familie gesprochen habe, habe ich auch die Geschichte von meinen Großeltern erwähnt, weil ich finde, dass das erzählt gehört. Ich wurde aber auch nur selten danach gefragt. Das erste Mal habe ich darüber gesprochen, als Jakob Augstein 2005 ein Porträt von mir für die ZEIT geschrieben hat.
Können Sie sich vorstellen, sich irgendwann literarisch der Geschichte Ihrer Familie zu nähern?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß aber noch nicht, wie und auf welche Weise. Das ist etwas, mit dem ich künstlerisch sehr vorsichtig umgehen würde und dem ich mich nur langsam annähere, weil es mit einer sehr großen Verantwortung einhergeht. Ich glaube, es gibt eine moralische Verpflichtung, dass, wann immer man sich diesem ungeheuren Thema Holocaust nähert, das Ergebnis extrem gut sein sollte. Man sollte darüber also nichts Mittelmäßiges schreiben oder gar einen mittelmäßigen Roman aufzuwerten versuchen, indem man noch am Rande den Holocaust thematisiert.
Welches Verhältnis haben Sie selbst zum Judentum?
Wenn man wie ich eine jüdische Familiengeschichte hat, fühlt man sich der jüdischen Kultur automatisch verbunden. Andererseits bin ich aber kein Jude. Meine Mutter ist keine Jüdin, mein Vater war getauft, ich bin getauft und habe eine katholische Schule besucht. Es gibt gerade im Kulturbetrieb viele Menschen, die sich aufgrund entfernter jüdischer Verwandter als Juden sehen. Das kommt mir sehr prätentiös vor. Was mich selbst erstaunt, ist, dass ich seltsamerweise noch nie in Israel war, obwohl ich viel reise und das Land immer schon einmal sehen wollte. Vielleicht zögere ich, weil ich nicht genau weiß, wie jüdisch ich mich fühlen soll, wie nahe ich dem Land Israel überhaupt bin. Womöglich scheue ich den Identitätskonflikt, der aus einer Israelreise entstehen würde.
Das Interview führte Philipp Peyman Engel.