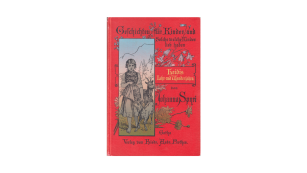Ich habe ein Faible für den Gemeindetag, daher kann ich drei Limmuds in zehn Tagen nicht abschlagen: Johannesburg, Kapstadt, Durban!
Es beginnt mit einem Kongress der Yale University gemeinsam mit dem Johannesburg Holocaust and Genocide Centre zu dem Thema »Still searching for Memory and Justice«. Teilnehmer und Vortragende sind Juden, Überlebende des Völkermords in Ruanda und Experten für Genozide weltweit.
Es fühlt sich fast an wie zu Hause, als am Eröffnungsabend Tali Nates, die Museumsdirektorin, und Stephen Naron, der Direktor des Fortunoff-Archivs der Yale University, mit den Worten beginnen: »Erst die Bitterkeit und die Wut vertreiben, dann an Versöhnung denken, vielleicht.« Der Tänzer Prince, so heißt der überlebende junge Mann, präsentiert auf der Bühne seine Erfahrungen bei einem Massaker in Ruanda, dem er entkommen ist.
Das Museum heißt »Johannesburg Holocaust and Genocide Centre«. Ich frage mich: Wäre das in Deutschland möglich, wo der Schwerpunkt auf der Singularität der Schoa liegt? Kein Genozid ist mit einem anderen vergleichbar. Aber was das Überleben, die Wunden, Heilung und Resilienz betrifft, können wir einander zuhören, vielleicht sogar helfen. Ich bin gespannt auf die Panels. »History in a multidirection«: Das ist das Erste, was ich hier lerne. Die Themen sind mir nicht neu. Erinnerung. Gerechtigkeit. Strafe. Heilung. Aber dass es nicht nur in Richtung Schoa geht, ist für mich neu und überraschend
Was hilft den Überlebenden, weiterleben zu können?
Was hilft den Überlebenden, hier lieber Opfer genannt, weiterleben zu können? Hilft es zu wissen, dass die Verfolger, die man hier Kriminelle nennt, bestraft werden? Oder hilft es, mit ihnen in Kontakt zu treten, ihre Entschuldigung anzuhören und anzunehmen? Ich erinnere mich an Seminare mit Kindern von Holocaust-Überlebenden und Kindern und Enkeln von Nazis oder Mitläufern.
Wie viele dieser Seminare funktioniert haben, weiß ich nicht, aber ein paar Freundschaften sind daraus entstanden. Immerhin. Prince, der Tänzer vom Vorabend, erzählt seine Geschichte. Schon allein, dass er hier Zuhörer gefunden hat, an einem Ort, wo seine und die Geschichte seines Stammes ernst genommen werden, hilft ihm. Denn sie müssen weiter zusammenleben, Opfer und Täter, Tutsi und Hutu, nach dem Völkermord an bis zu einer Million Menschen im Jahr 1994.
»Erst die Bitterkeit und die Wut vertreiben, dann an Versöhnung denken, vielleicht.«
Carl Wilkens, ein Entwicklungshelfer, der während des Genozids an den Tutsi als einziger Amerikaner in Ruanda blieb und Schreckliches gesehen hat, stellt klar, dass Genozide nicht einfach so passieren. Klare Warnsignale gehen immer voraus. Er zieht nach 30 Jahren folgenden Schluss: Es kann nicht um Gerechtigkeit gehen, sondern um Heilung. Ich denke: Das muss ich mir merken. Bald wird es in Israel und Gaza darum gehen. Was wird am »Tag danach« passieren? Wie werden die Menschen den Krieg verkraften können, die Verbrechen, die an ihnen verübt wurden? Auf beiden Seiten so viel Leid. Wie wird es funktionieren, kann es das überhaupt?
Ich spüre, wie mir schwindelig wird, vor lauter Hypothek.
Ich erfahre einiges über den Werdegang des ehemaligen Apartheidstaates, der jetzt Israel vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag der Apartheid beschuldigt. Es ist eine lange, komplizierte Geschichte zwischen Israel und Südafrika. Israel lieferte der Apartheidregierung Waffen, Südafrika lieferte Uran. Während der Apartheid in Südafrika hielten sich die jüdischen Gemeinden im Land vornehm zurück. Es ging ja nicht um Antisemitismus … Es gab allerdings auch etliche Juden, die sich gegen die Apartheid auflehnten und dafür mit ihrem Leben bezahlen mussten.
Die derzeitige israelische Regierung trägt rechtsextremistische Züge, erinnert Südafrikaner also möglicherweise an ihre eigene Vergangenheit. Statt sich der eigenen Geschichte zu stellen, wird in Südafrika gern der Holocaust bemüht. Traumata und Schmerz lassen sich nicht vergleichen. Doch die Opfer anzuhören, sie ernst zu nehmen, ihnen Würde und Wertschätzung zurückzugeben, die man ihnen genommen hatte, ist möglich – und notwendig.
Das erste Limmud findet in Kapstadt statt. Auch hier heißt der Veranstaltungsort »Holocaust and Genocide Centre«, im Gegensatz zu der Historikerkonferenz sind aber hauptsächlich Juden vor Ort. Zum ersten Mal seit Längerem treffe ich auf Israelis, sie wurden zuletzt von vielen Konferenzen ausgeladen. Ihre Veranstaltungen sind die vollsten. Man spürt, dass die Zuhörer wissen möchten: Wie kam es zu dem jüngsten Krieg? Und wie kommen wir da wieder raus?
Genauso altmodisch wie liebenswert
Fast 10.000 Kilometer trennen Südafrika und Israel, Palmen stehen im Innenhof des Gartens. Wir sind sehr weit weg von Jerusalem und von Berlin, vielleicht können hier deshalb die Gedanken freier kreisen. Natürlich kommt es unter den Vortragenden, Linken oder auch sehr Rechten, Siedlern und Historikern zu Spannungen. Aber die Umgangsregeln bei Limmud sind klar: kein Geschrei, keine Vorwürfe, keine Beleidigungen.
Die Leitlinien der Veranstaltung, sich respektvoll zu begegnen, werden zu 100 Prozent eingehalten. Man hört einander zu, die Kommentare sind kurz, die Bemühungen um Lösungsvorschläge groß. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Die Debatten bei uns waren in den vergangenen Monaten, was Aggression betrifft, kaum noch zu toppen. Bei Limmud sind sich so gut wie alle einig, dass sich die Lage unter der Regierung von Benjamin Netanjahu kaum ändern wird, auch weil es unter den Israelis einen enormen Rechtsruck gegeben hat. Dabei wären Friedensverhandlungen mit den Nachbarländern einer der ersten möglichen Schritte.
Den Rest des Tages verbringe ich in Kapstadt. Es ist Sonntag, ich gehe spazieren, die Townships sind weit draußen, in der Innenstadt sind die Straßen wie leergefegt. Kleine Gruppen von schwarzen jungen Männern ziehen an mir vorbei. Ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass während der Apartheid kein Schwarzer nach 17 Uhr auf der Straße sein durfte. Diese Zeit wirkt noch traumatisierend nach.
Ein paar Tage später bin ich bei meinem zweiten Limmud-Treffen in Durban. Dort gibt es einen jüdischen Klub von 1919, genauso altmodisch wie liebenswert. Um den alten Ballsaal herum ist das moderne Holocaust- und Genozid-Zentrum gebaut. Claudia, die Direktorin des Museums, erzählt mir, dass jeden Tag der Strom ausfällt. Im Zentrum von Johannesburg manchmal sogar für acht Stunden: »Wir wünschen uns nicht viel: Wasser, bezahlbare Wohnungen, Essen und Licht.« Ich denke: Wie verwöhnt sind wir eigentlich?
Wir sind bei Gastfamilien untergebracht. Ich bei Rooda, sie wohnt in einer Gated Community, nur Juden, eine Bubble, wie sie es nennt, aber »sehr sicher«. Die Schul ist neu und groß, die Juden sind aus einem anderen Viertel hergekommen, weil in ihres, so sagt sie, »zu viele Muslime« gezogen seien. Rooda ist sehr gastfreundlich und sehr religiös. Lange sprechen wir über den Krieg in Israel und Gaza, unsere Meinungen sind recht verschieden, gegen zwei Uhr gehen wir erschöpft schlafen.
Ich habe selten so entspannte Tiere (und Juden) gesehen.
550 Limmudniks
Beim Limmud in Johannesburg wird es am nächsten Wochenende 140 Vorträge geben. Zunächst aber hat man eine Safari für uns geplant, 27 Juden, mitten in der Pampa. In meinen Jeep sitzen zwei Rabbinerinnen und ein Rabbiner. Dass es einen Segensspruch gibt, wenn man einen Elefanten sieht oder ein anderes besonderes Tier, wusste ich bisher nicht. Hier, in den frühen Morgen- und Abendstunden, zwischen Geparden, Elefanten und Giraffen, lerne ich Channah und Gil, Tarlan und Shai ganz anders kennen. Wie sie Alija gemacht haben, oder warum sie in Toronto leben, wie sie Rabbinerinnen wurden, und wie schrecklich es ist, jetzt in allen anderen Teilen der Welt ausgeladen zu werden. Für ein paar Tage vergessen wir den Krieg. Fast. Ich habe selten so entspannte Tiere (und Juden) gesehen.
550 Limmudniks, die Aufregung ist groß, das Chaos auch, schließlich haben in Johannesburg alle ihre Zimmer, und es kann losgehen. Vier Rabbinerinnen und Rabbiner teilen sich ein Podium. »Was ist im Moment das Wichtigste?«, so lautet die Aufgabenstellung. Einer der Punkte, die genannt werden: »Waffenstillstand«. Die pessimistische Ansicht auf dem Podium: »Netanjahus Regierung wird den Krieg auf ewig fortführen, die Geiseln werden nie freikommen. Mit der jetzigen Siedlungspolitik wird Israel sich selbst auflösen.« Die optimistische Meinung: »Es gab immer wieder überraschende Wendungen in Israel, im Nahen Osten, vielleicht auch jetzt.«
In einer Pause erfahre ich von Wayne Sussman, einem der freiwilligen Organisatoren, dass bis zwei Wochen vor Start der drei Limmuds in Südafrika nicht klar war, ob die Israelis würden kommen können. Auch war man sich unsicher, ob es besser wäre, sie ohne Namen anzukündigen, der Sicherheit wegen. Die Organisatoren beruhigten die Sponsoren, die Teilnehmer und ja, auch sich selbst, sie hätten einen Plan B. Alles ist gut gegangen, in Johannesburg haben sich 550 Teilnehmer angemeldet, das größte Limmud-Festival im Land bisher. Sie hätten ohnehin keinen Plan B gehabt …
Missverständnisse, Auswegmöglichkeiten, Verhandlungsspielraum – hinter diesen Themen der Panels stehen immense Sorge und Ratlosigkeit. In einem der letzten Panels weint eine schwarze Frau, als sie von Vergewaltigungen und Morden an ihrer Familie während der Apartheid erzählt. Die Wunden sind noch lange nicht geheilt.
Zwölf vollgepackte Tage, viele Fragen, einige Antworten. Der Wunsch, weiter zu lernen. Limmud eben.
Die Autorin ist Schauspielerin, Regisseurin und Schriftstellerin.