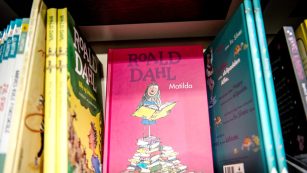Grzegorz Artman ist ein Visionär. Der 38-jährige freie Künstler, der im Auftrag der polnischen Stadt Kielce die Planung und Organisation eines Begegnungs- und Erinnerungszentrums übernommen hat, spricht weniger über Details als über Ideen: Obgleich das Konzept noch längst nicht fertig ist, sei es Ziel, »einen Ort zu schaffen, der in der Sprache der Künste Themen kommuniziert, die in bloßen Worten schwierig zu beschreiben sind«.
Dabei soll die Erinnerung an das Pogrom von Kielce zentraler Bestandteil des umgebauten Gebäudes werden. Am 4. Juli 1946 ermordete eine aufgebrachte Menge von Polen 42 polnische Juden in der Stadt. »Dieses Ereignis wird ein Kern der Gedenk- und Begegnungsstätte sein«, sagt Artman. Ziel ist es, dass der Schweizer Architekt Peter Zumthor, der »weltweit für ähnlich angelegte, geistige Projekte hochgeschätzt« sei, »einen Ort schafft, der an dieser Stelle ein Symbol der Erneuerung wird«, so Artman.
Nach Angaben von Wojciech Lubawski, Präsident der Stadt Kielce, hat Zumthor, der vergangenes Jahr mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wurde, zugesagt, den Umbau der heute als Staatsarchiv genutzten alten Synagoge zu übernehmen. Noch im Frühjahr soll der Architekt zu Besuch in die Stadt kommen.
begegnungszentrum In dem Gebäude, das auf zwei Ebenen eine Fläche von rund Tausend Quadratmetern hat, soll ein Zentrum der Begegnungen von Kultur und Religionen entstehen. Artman möchte in der Frage der Beteiligung von Peter Zumthor vorerst lieber etwas tiefer stapeln. »Die Verhandlungen mit Herrn Zumthor sind zwar in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, aber ich bin vorsichtig, solange wir es noch nicht in trockenen Tüchern haben«, sagt er. Vor vier Jahren hat es den Warschauer nach Kielce verschlagen. Die 200.000-Einwohner-Stadt eine Autostunde nordöstlich von Krakau genießt auch im heutigen Polen keinen guten Ruf. Dies liegt vor allem an ihrer Randlage und der schlechten Verkehrsanbindung.
Nach Aussage von Artman befindet sich das Projekt zurzeit in der Organisationsphase. Details zu Terminen und Kosten kann der Künstler nicht nennen, jedoch werde die Stadt für die Organisation zuständig sein und als Träger auftreten. Das Gebäude soll auch von außen umgebaut werden. »Eine Konzeption ohne äußeren Umbau ist schwer vorstellbar«, sagt Artman. Geplant sei es, dem Gebäude seine ursprüngliche Form wiederzugeben und jene »realsozialistischen« Elemente zu entfernen, die nach dem Zweiten Weltkrieg hinzugefügt wurden.
Tatsächlich fallen die Unterschiede zwischen dem heutigen Zustand und der ursprünglichen Form der Synagoge schnell ins Auge. Das Gebäude wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Moses Pfefer, einem Vorstandsmitglied der damaligen jüdischen Gemeinde von Kielce, gestiftet. 20.000 Rubel kostete der 1909 fertig gestellte Bau, den der Stadtarchitekt Stanislaw Szpakowski entworfen hatte. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Innere der Synagoge zerstört, 1945 zündete man das Gebäude an. Nach dem Krieg wurde es im Stil des Klassizismus und des sozialistischen Realismus umgebaut und den Erfordernissen des 1955 eingezogenen Stadtarchivs angepasst.
idee Artman möchte mit dem umgebauten Gebäudes folgende Grundidee verwirklichen: »Vier Bürger in vier Dimensionen und in vier Richtungen der Welt«. Die vier Dimensionen sollen aus den Bereichen Begegnungen, Literatur, Stille und Theater bestehen. »Für jeden dieser Bereiche könnten Kuratoren eingesetzt werden. Das gegenseitige Ineinanderfließen der Bereiche soll das Durchdringen der vier Welten symbolisieren – und ein einmaliges Ergebnis zeitigen«, sagt Artman, der jahrelang unter anderem als Schauspieler auch in unabhängigen Theatergruppen wirkte. Judentum und Christentum werden dabei die Eckpfeiler sein. Schließlich ist es ein Zentrum für die Begegnung von Kultur und Religion. Es solle zwar als ein Objekt der polnischen Kultur verstanden werden. Doch: »Mir ist wichtig, dass dieser Ort auch über die Grenzen Polens hinaus wahrgenommen wird.« Und für die Aufmerksamkeit soll in einem ersten Schritt nicht zuletzt Zumthor sorgen.
Heute gibt es keine jüdische Gemeinde mehr in Kielce. In der Schoa sind rund 27.000 Juden aus dem Kielcer Ghetto ermordet worden. Nach dem Pogrom im Jahr 1946 verließen die wenigen damals noch in der Stadt lebenden Juden das Land.