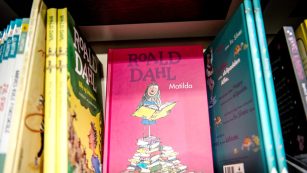Herr Rappaport, Sie führen dieses Jahr das jüdische Filmfestival »Yesh!« zum 10. Mal durch. Ein Grund zum Feiern? Oder ist Feiern dieses Jahr nicht zulässig?
Das haben wir uns während der Vorbereitung des Festivals permanent gefragt. Der 7. Oktober war omnipräsent genauso wie die Frage, wie wir als Filmfestival dieser Katastrophe auf alle Seite hin gerecht werden.
Werden Sie es?
Das entscheidet letztlich das Publikum, das wir zum Reflektieren und Diskutieren anregen möchten. Wir sehen uns als Plattform für kulturellen Austausch und gelebte Vielfalt. Die meisten Filme haben direkt mit dem 7. Oktober nichts zu tun. Aber durch den aktuellen Kontext werden sie ganz anders verstanden.
Sie sprechen israelische Filme wie »Knock on the Door« an, in dem es um die Überbringung einer Todesnachricht, die jeweils militärisch sehr präzise von einer spezifischen Abteilung an von Offizieren überbracht werden muss, geht?
Das ist im Grunde genommen nichts Neues, aber birgt vor dem aktuellen Kriegskontext viel mehr Brisanz. Auch »Tel Aviv Beirut« ist ein Film über Familien, die durch den israelisch-libanesischen Konflikt beeinträchtigt sind und beidseits der Grenze leben. Auch hier ist die Thematik keinesfalls neu, aber leider aktuell.
Inwiefern gestaltete sich im Schatten des Krieges die Vorbereitung auf das diesjährige Filmfestival anders als die vorderen Jahre?
Nach dem Schock des 7. Oktobers war ich zunächst sehr frustriert. Auf einmal schlugen gelebter Hass und der überall grassierende Antisemitismus dem Dialog und der Verständigung, wofür Filmschaffende sich jahrzehntelang für eingesetzt haben, ins Gesicht. Haben denn all die Jahre der dieser Arbeit nichts gebracht? Wir mussten uns erst einmal fangen. Und allmählich begriffen wir: Jetzt erst recht müssen wir »Yesh!« weiterführen, das Publikum zusammenbringen und zu Denkanstößen verhelfen.
Wie gingen Sie vor?
Unser Anspruch ist es, nur Neuerscheinungen zu zeigen. Doch die meisten Filme haben eine lange Vorlaufzeit. Das kann manchmal bis zu vier Jahren oder länger dauern. Da war die Welt noch in Ordnung, zumindest teilweise, und Filmschaffende beschäftigen gesellschaftliche Fragen oder wälzten andere Probleme. Das hat zur Folge, dass die meisten Filme, die im letzten Jahr herauskamen, den aktuellen Krieg in Israel und in Gaza noch nicht im Fokus hatten.
Eine Ausnahme bildet »Supernova«, ein Dokumentarfilm aus Versatzstücken von Filmaufnahmen der Hamas-Terroristen, die den Schrecken des Massakers mit ihren Handys aufnahmen, und aus Interviews mit überlebenden Festivalbesuchenden. Wie zulässig ist es, solches Filmmaterial überhaupt zu zeigen?
Es ist zulässig. Der Schrecken sitzt tief in unseren Knochen, aber er ist dokumentiert. Dann soll er auch gezeigt werden. Der Film zeigt auch, wie solche Aufnahmen verwertet, kontextualisiert werden. Gäbe es diese Aufnahmen nicht, wäre es ein anderer Film. Es ist der unmittelbarste Film in unserem aktuellen Programm, er erschüttert. Aber wir wollten ein Zeichen setzen. Deshalb zeigen wir ihn.
Jedes Publikum braucht seine Filme. Das jüdische genauso wie das nichtjüdische.
Was hat sie dazu veranlasst, Filme wie »No Other Land« oder »Israelism« ins Programm aufzunehmen? Beide Filme haben weltweit für viel Kritik und Furore gesorgt, wurden zum Teil nicht gezeigt oder führten zu heftigen Debatten wie an der Berlinale.
Alles, was die Debatte bei »No Other Land« dieses Jahr an der Berlinale entfachen ließ, entstand außerhalb des Kinosaals. Natürlich wurde ich neugierig und wollte den Film sehen. Es ist ein aufwühlender Film. Die Gewalt der rechtsnationalen israelischen Siedler und die Zerstörung palästinensischer Häuser durch die israelische Armee sind ein Fakt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich sehe nichts Antisemitisches dabei. Es kann sein, dass die Leute den Film unter diesem Aspekt schlecht redeten, aber das zeigt nur, wie angeheizt die Situation im Januar war. Vermutlich ist es darum derjenige Film in unserem Programm, der in der Öffentlichkeit am meisten interessiert. Aber jedes Publikum braucht seine Filme. Das jüdische genauso wie das nichtjüdische.
Das müssen Sie ausführen.
Wir sind eine Plattform, die nichts beschönigen will. Wir kuratieren und bilden nur ab, was der Markt hergibt. Für ein eher jüdisches Publikum haben wir Filme im Programm, die man sich im normalen Kinoprogramm nicht zu Gemüte führen würde, dazu gehört »No Other Land«, aber auch »Israelism«. Für ein nichtjüdisches Publikum zeigen wir Filme, die Einblicke geben in jüdische Lebenswelten, Geschichte und Religion bieten. Aber natürlich ist dies nicht so eindeutig zuordenbar, die Interessen sind vielschichtig.
Sie sprechen »Israelism« an. Das San Francisco Jewish Film Festival zeichnete ihn als besten Dokumentarfilm aus. US-Universitäten hingegen sagten seine Vorführung ab. Die Zürcher Zentralwäscherei zeigte ihn Anfang 2024. Es kam zur dringlichen Anfrage an den Zürcher Stadtrat: »Israelism« bediene antisemitische Stereotypen. Sie haben als Festivalchef auch eine Verantwortung: Spielen Sie hier nicht mit dem Feuer?
Nein, warum auch? Wir wollen Israel nicht schlecht machen, indem wir einen solchen Film bringen. Es geht dabei um eine innerjüdische Debatte, vor allem um eine, die in den USA geführt wird: Wie junge jüdische Menschen von Kind auf ein glorifiziertes Bild von Israel vermittelt wird, ohne groß auf die Thematik mit den Palästinensern einzugehen. Der Film macht klare Ansagen, hat was sehr Amerikanisches. Doch auch hier handelt es sich um eine Realität, wie sie mancherorts gelebt wird und das hinterfragt der Film. Das zu zeigen, ist legitim. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Film ein zu eins unsere Meinung abbildet.
Was meinen Sie damit?
Ich betrachte alle Filme als Türöffner, weil ich finde, gerade jetzt ist es mehr als angebracht zu diskutieren. Wenn ein Film wie »Israelism« schon nur zu Selbstreflexion anregt, finde ich, ist viel erreicht. Wir stehen hinter jedem Film, den wir zeigen, aber nicht hinter jeder Aussage, die in einem Film gemacht werden. Aber jede Aussage ist es wert, reflektiert zu werden.
Kann man nach dem 7. Oktober überhaupt noch unpolitische Filme in Israel machen?
Es sind immer noch Menschen, die Filme machen. Menschen wollen lachen, sie wollen sich vergnügen und verdrängen damit auch automatisch. Damit ebnen sie auch den Weg für andere universelle Themen. Auch der Holocaust bleibt für das Kino wichtig. Denn die Zeitzeugen sterben weg.
Trotzdem wird sich der israelische und jüdische Film durch diese Zäsur vermutlich verändern ...
Auf jeden Fall. Der 7. Oktober hat eine ganze Palette von latenten Themen angespült, die die Menschen nun noch mehr beschäftigen. Ängste, Verfolgung oder Antisemitismus sind nur einige davon. Sie waren immer da. Aber nun sind sie nicht mehr wegzudenken. Wie stark das filmisch verarbeitet wird, wird sich allerdings erst noch zeigen. Die Pandemie war ebenfalls eine Zäsur, wenn auch in einem anderen, internationaleren Kontext. Dieser hat die israelische Filmbranche zuerst ausgebremst. Es gab sozusagen einen Covid-Stau. Danach kamen umso mehr Filme auf den Markt. Wie ich aus Filmkreisen weiß, wird derzeit nicht viel produziert. Das kann sich auf einmal ändern, der 7. Oktober mit seinen Folgen wird die Inhalte der zukünftigen Filme auf die eine oder andere Art bestimmen.
Es hat einen anderen Wert, sich einen Film außerhalb von zu Hause anzuschauen
Wie betrachten Sie als Festivaldirektor generell den Wandel des Kinos? Kann die Leinwand bei Netflix und Co. längerfristig mithalten?
Die Streamingplattformen sind eine Realität, die nicht mehr wegzudenken ist und das geht auf Kosten des Kinos. Ins Kino zu gehen, wird vielleicht irgendwann so wie wenn man das Theater oder in die Oper besucht. Es hat einen anderen Wert, sich einen Film außerhalb von zu Hause anzuschauen.
Sie haben erwachsene Kinder. Wie oft geht die nächste Generation ins Kino?
Nicht mehr so viel wie zum Beispiel ich. Ich wurde durch die Leinwand sozialisiert. Aber als Festival sind wir bemüht, auch junge Menschen in den Kinosessel zu bringen. Wir haben auch dieses Jahr eng mit den lokalen Schulen zusammengearbeitet. Es gibt viele Schulvorstellungen. Einerseits um auch die jüngeren Menschen für jüdische Themen zu sensibilisieren, andererseits natürlich auch um ihnen die Filmkunst generell und die Kinoatmosphäre näherzubringen.
Was versprechen Sie sich vom diesjährigen Yesh-Jubiläum?
Es ist sicher die politischste Ausgabe unseres Festivals. Gleichzeitig erhoffe ich mir, dass viele Leute kommen und sich gut unterhalten sind und wir unserem filmischen Anspruch gerecht werden. Und natürlich hoffe ich auf wenig Nebengeräusche.
Zum Schluss: Was ist Ihr persönlicher Filmtipp?
Mich hat »Tel Aviv Beirut« sehr berührt. Auch »Transmitvah« finde ich eine sehr gelungene Komödie, die wichtige Identitätsfragen aufwirft und trotzdem musikalisch beschwingt und bildstark daherkommt.
Das Gespräch mit dem Direktor des Filmfestivals führte Nicole Dreyfus.
Das Filmfestival »Yesh!« beginnt am 7. und dauert bis zum 14. November. Die Filme werden in den Zürcher Kinos Riffraff und Houdini gezeigt.