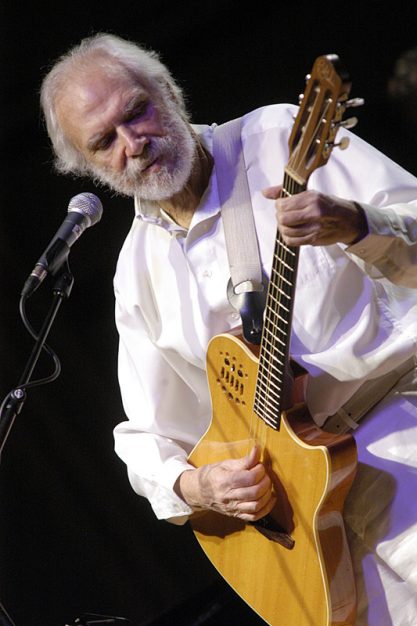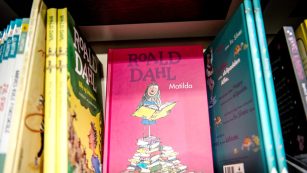Hören Sie gern Songs von Lucien Ginsburg? Bewundern Sie die Einfühlsamkeit der Lieder von Joseph Mustacchi? Oder zählen Sie zu den Verehrern der Bilder von Mosche Shagalov? Wenn Ihnen diese Namen nichts sagen, ist dies kaum verwunderlich. Es handelt sich um die Geburtsnamen des Sängers Serge Gainsbourg, des Chansoniers Georges Moustaki und des Malers Marc Chagall. Sie alle eint, dass sie ihren jüdisch klingenden Namen zugunsten französisch anmutender Versionen aufgaben.
Hatten sich einzelne Einwanderer aus Integrationseifer auch schon vor dem Krieg einen anderen Namen verpasst, so wandelte sich diese Praxis in Frankreich nach der Schoa zum Massenphänomen: Mehrere Tausend jüdische Flüchtlinge, die sich in Frankreich niederlassen wollten oder im Versteck überlebt hatten, sehnten sich infolge des überstandenen Horrors nach großer Unauffälligkeit und irgend möglicher Normalität. Da zudem auch die französische Nachkriegsgesellschaft nicht frei von Antisemitismus war und die Einwanderungsbeamten den Neufranzosen oftmals keine wirkliche Wahl ließen, entschieden sich viele dazu, den radikalen Schnitt mit der Vergangenheit zu vollziehen. Aus Wolkowicz wurde Volcot, aus Rozenkopf Rosent und aus Fajnzylber Fazel.
fehlstelle Auch wenn sich viele mit dem Verlust des alten Namens nie ganz anfreunden konnten, riss oft erst die Geburt eines Kindes die alte Wunde wieder auf und machte die Fehlstelle sichtbar: Die mittlerweile fest in der französischen Gesellschaft verankerten Einwanderer waren mit der Frage konfrontiert, welche Identität und welchen Namen sie den Nachkommen weitergeben sollten. Obwohl sie fühlten, wie wenig der neue Name zu ihnen gehörte und wie sehr er die Familiengeschichte überdeckte, blieb ihnen eine wirkliche Wahl aber auch dieses Mal versagt. Denn das Gesetz erlaubt zwar die Romanisierung von Namen, nicht aber ihre Rückwandlung in die ursprüngliche, »weniger französische« Form.
Nicht nur dieser Raub der Identität, sondern auch die Willkür, was als französischer Name zu gelten hat, brachte Céline Masson, deren Vater ursprünglich den sefardischen Namen Hassan trug, dazu, mit anderen jüdischen Intellektuellen die Initiative »La force du nom« (Die Kraft des Namens) zu gründen, um für die Wiedererlangung der Namen zu streiten: »Warum soll man mit einem jüdisch klingenden Namen kein Franzose sein können, zumal viele elsässische Namen wie Hoffmann gang und gäbe sind und den jüdischen vollkommen gleichen?«
Die Gruppe veranstaltete kürzlich unter Mitwirkung von Psychoanalytikern und Historikern in Paris und Jerusalem zwei Kolloquien, bei denen über die Bedeutung des Namens für Identitätsbildung und Traditionsübermittlung referiert wurde. Zusammen mit der Anwältin Nathalie Felzenszwalbe sammeln sie nun Anfragen von Familien, die ihren Namen zurückbekommen wollen, um sie bei den Behörden einzureichen. Über die bisher zehn gesammelten Dossiers soll nun Fall für Fall entschieden werden.
laizismus Ob bei den angerufenen Gerichten unterdessen stärkere Einsichtigkeit gereift ist, scheint fragwürdig, was sicher auch im Zusammenhang mit einem schon länger schwelenden Konflikt um das Selbstverständnis der französischen Gesellschaft zu sehen ist: Bei vielen wächst die Angst, dass sich die »laizistische und unteilbare« Republik, wie es gleich im ersten Artikel der Verfassung der Grande Nation heißt, in einen multikulturellen Flickenteppich aus unvereinbaren Communities verwandeln könnte. Die bloße Erkennbarkeit der Herkunft im Namen wird dies sicherlich nicht zur Folge haben, allerdings warten schon einige Franzosen afrikanischer und arabischer Herkunft auf einen Präzedenzfall, um ihre ebenfalls abgegebenen Namen wiederzuerlangen.
Auch die Tatsache, dass Franzosen, die schon in der dritten Generation mit dem neuen Namen leben und nun wieder den des Großvaters anzunehmen wünschen, zeigt, dass es wichtiger geworden ist, woher man kommt. Die Abstammung fließt – nicht nur bei Juden – stärker in die Identitätsbildung ein.
So würden denn wohl viele Betroffene in Kauf nehmen, dass deutsche Namen wie Rebenwurzel oder gar Katzenellenbogen den ein oder anderen Knoten in die französische Zunge zaubern könnten. Denn wie war in den Kolloquien zu hören: Nicht wir betonen die Namen, die Namen betonen uns.