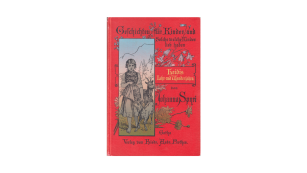»Ich bin gezwungen, mich in einer wichtigen Sache an Sie zu wenden«, schreibt Leo Trotzki 1914 in einem Brief an Victor Adler. »Ich muss mir unbedingt irgendwo 300 Kronen ausleihen.« Der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen, Trotzki muss Wien verlassen. Adler zögert nicht lange. Mit dem Geld flieht Trotzki über die Schweiz nach Frankreich, bis er später nach Spanien und in die USA abgeschoben wird. Als 1917 der Zar abtritt, kehrt Trotzki wieder nach Russland zurück.
Victor Adler, der Begründer der österreichischen Sozialdemokratie, als Fluchthelfer für den russischen Revolutionär: Es ist nur eine der vielfältigen Verbindungslinien zwischen Wien und Moskau, die in der Ausstellung Genosse. Jude. Wir wollten nur das Paradies auf Erden gezeigt wird. Das Jüdische Museum Wien erzählt die Geschichte der Oktoberrevolution und der Sowjetunion aus einer Wiener, aber auch aus einer jüdischen Perspektive. Sowohl Trotzki als auch Adler waren Juden.
Sowjetunion Österreich und Sowjetrussland waren nach dem Ersten Weltkrieg zwei Länder, die mehr trennte als knapp 2000 Kilometer. Hier der Zerfall der Monarchie, die Erste Republik und der Aufstieg des Nationalsozialismus. Dort die Anfänge der Sowjetära, geprägt von Aufbruch und Euphorie, aber auch vom Bürgerkrieg.
Die Ausstellung versucht, diese Welten über das Leben österreichisch-jüdischer Kommunisten zu verbinden – wie etwa Otto Pohl, ein österreichischer Sozialist, der nach dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk für die Kriegsgefangenenkommission nach Moskau reiste und zum ersten österreichischen Gesandten in der Sowjetunion wurde. Oder Elisabeth Markstein, die Tochter des KPÖ-Vorsitzenden Johann Koplenig, die mit ihrer Familie in den 30er-Jahren ins politische Exil nach Moskau ging.
»Wir wollten nur das Paradies auf Erden«, dieses Zitat von Prive Friedjung, einer jüdischen Kommunistin aus der Bukowina, wurde namensgebend für die Schau. Es bezieht sich auf eine Hoffnung, die sich in den intellektuell und künstlerisch produktiven Anfangsjahren der Sowjetunion entlud, an denen Juden einen großen Anteil hatten.
Ernüchterung Diesem Aspekt wird in der Ausstellung viel Platz eingeräumt: vom russischen Avantgarde-Künstler El Lissitzky bis hin zu Birobidschan, dem Traum vom »Roten Zion« im russischen Fernost. Die Ernüchterung kam indes schon mit dem Stalin-Terror, der die Juden als »wurzellose Kosmopoliten« verfolgte. Diese Wende verdichtet sich in der Ausstellung in einem eigenwilligen, aber eindringlichen Objekt: einem Wandteppich mit Stalins Konterfei aus den 30er-Jahren, später übermalt mit einem Theodor-Herzl-Bart.
Eine Fundgrube sind die Karikaturen von Boris Jefimow (1900–2008), die sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung ziehen. Der jüdische Zeichner illustrierte mit seinen bissigen Karikaturen die sowjetische Ära bis zu ihrem Zerfall – als »Tinten-Kuli des Apparats«, wie er sich selbst bezeichnete. Doch auch seine Familie blieb nicht von den Repressionen verschont. Sein Bruder wurde als »Konterrevolutionär« verhaftet und 1940 erschossen.
»Russische Revolution und jüdisches Problem, das muss jeden aus der Ruhe bringen, der sich damit befasst, handelt es sich doch um eine höchst komplexe und vielschichtige Frage«, wird der galizisch-jüdische Kommunist Isaac Deutscher in der Ausstellung zitiert. »Nichts wäre leichter, nichts aber auch schädlicher, als diese Frage zu simplifizieren und womöglich Schuld zuzuteilen – die Juden schuldig zu sprechen oder die Revolution oder die Russen.«
topos Mit diesem Zitat vor Augen haben Gabriele Kohlbauer-Fritz und Sabine Bergler die Ausstellung kuratiert: dokumentieren statt kommentieren. Um eine Frage kommen die Kuratorinnen allerdings nicht herum: Wie stellt man den antisemitischen Topos vom »jüdischen Bolschewismus« dar, der bis heute durch den Diskurs geistert? In der Ausstellung werden diese Objekte nicht im Original, sondern bewusst in Reproduktionen gezeigt und von den anderen Ausstellungsstücken auch mit einem Balken optisch abgehoben.
Es ist eine detailreiche Schau, die mit nur einem Besuch kaum zu überblicken ist. Selbst wer in der sowjetischen und in der jüdischen Geschichte beschlagen ist, wird hier viel Neues entdecken.
Die Ausstellung ist bis zum 1. Mai 2018 im Jüdischen Museum Wien, Dorotheergasse 11, zu sehen.
www.jmw.at