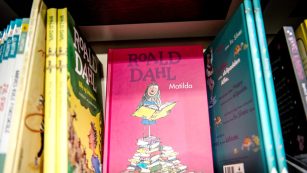Vernünftige Politik kommt nicht ohne Prinzipien und Werte aus, ist aber auch eine Frage von Interessen. Wenn sich Interessen und Werte aber widersprechen, entsteht ein politisches Dilemma. Der amerikanische Publizist Irving Kristol hat 1984 festgestellt, dass die Juden in den Vereinigten Staaten vor genau solch einem Dilemma stehen würden. Eine große Mehrheit der Juden, schrieb er in der vom American Jewish Committee gegründeten Zeitschrift »Commentary«, stehe loyal zum amerikanischen »Liberalismus«, also zur Linken, obwohl ihre ökonomischen, religiösen, kulturellen und außenpolitischen Interessen sie zu natürlichen Konservativen machten.
Kristol wusste, wovon er sprach. Selbst Jude und in jungen Jahren Trotzkist, später ein liberaler Demokrat, wechselte er am Ende der 60er-Jahre die Seiten. Als erster demokratischer Intellektueller akzeptierte er das Etikett »neoconservative«, das der Sozialist Michael Harrington liberalen Renegaten 1973 in pejorativer Absicht aufklebte. Vorher hatte sich Kristol als idealtypischer New Yorker Intellektueller einen Namen gemacht, als Journalist und Gründer von Zeitschriften.
Seine Bekehrung zum Neokonservatismus war für ihn also kein Bruch. Vielmehr betrachtete er diese als Antwort darauf, dass sich die Demokratische Partei nach dem Attentat auf John F. Kennedy im Jahr 1963 unter dem Einfluss von »New Left« nach links bewegt hatte. Sein Neokonservatismus kann als konservative Variante des amerikanischen Liberalismus verstanden werden. Er war ein Liberaler, der das liberale System vor den »Liberalen« retten wollte.
Anhänger des linken Liberalismus der Französischen Revolution
Es irritierte Kristol, dass sich die amerikanischen Juden nicht an dieser Rettungsaktion beteiligen wollten, sondern mehrheitlich Demokraten blieben. Warum war das so? Dafür präsentierte Kristol 1988 in einem weiteren »Commentary«-Artikel eine einzige, aber nicht einfache Erklärung: Die amerikanischen Juden seien Anhänger des linken Liberalismus der Französischen Revolution, dem sie ihre Emanzipation in Europa verdankten. Für die Tradition des gemäßigten angloamerikanischen Liberalismus hätten die aus Mittel- und Osteuropa eingewanderten Juden dagegen nur wenig Verständnis.
Erstaunlich daran sei nicht die Tatsache an sich. Linksliberale Vorstellungen hätten das intellektuelle Leben überall im Westen lange Zeit dominiert. Verblüffend fand Kristol aber die Hartnäckigkeit, mit der die jüdische Gemeinschaft daran festhielt, obwohl sie sich dadurch in den Zustand einer »kognitiven Dissonanz« versetzen würde. Die Folge sei, so habe es Milton Friedman einmal formuliert, dass »Juden in diesem Land den ökonomischen Status von weißen, angelsächsischen Anhängern der Episkopalkirche haben, aber wählen wie Hispanics mit niedrigem Einkommen«.
Wie viele Juden sind auch die authentischen Konservativen heimatlos geworden.
Dass die Mehrheit der Juden an der Wahlurne gegen ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen handelte, war für Irving Kristol jedoch nicht das Wichtigste. Schwerer wogen für ihn moralische und außenpolitische Widersprüche. Das Streben der jüdischen Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten nach einer Schärfung ihrer Identität, der Sinn für die lange Geschichte der jüdischen Religion und das Festhalten an traditionellen moralischen Überzeugungen – all das sprach Kristol zufolge gegen eine Nähe zur Demokratischen Partei.
So wies er in seinem Aufsatz von 1984 auf die Hilflosigkeit der jüdischen Gemeinschaft gegenüber dem Aufstieg der »Moral Majority« hin. Denn die christliche Rechte sei nicht, wie man hätte erwarten können, antisemitisch und anti-israelisch, sondern das Gegenteil. Bezeichnenderweise seien die Juden nicht in der Lage, sich mit dieser Bewegung innerhalb der Republikanischen Partei anzufreunden. Stattdessen hielten sie an den Demokraten fest, deren linker Flügel nicht immun gegen antisemitische Denkmuster sei.
Politisch heimatlos
Kristol folgerte daraus, dass die amerikanischen Juden politisch heimatlos seien. Es sei offen, ob ihnen der Neokonservatismus eine neue Heimat bieten könne und ob sie bereit wären, dieses Angebot anzunehmen. Doch auch die Juden müssten zur Kenntnis nehmen, dass sich die politische Landschaft verändert habe und weiter verändern werde.
In einem anderen Artikel über dieses Thema, den Kristol 1999 im israelischen Magazin »Azure« unter dem provokanten Titel »On the Political Stupidity of the Jews« veröffentlicht hatte, ging er sogar einen Schritt weiter: Amerikanische Juden und linksliberale Israelis müssten vom »utopischen Universalismus« lassen, um das Überleben der Juden und des Judentums in der Welt zu sichern. Neokonservatismus war nun keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit.
Hatte Kristol recht? Jüdische Gemeinschaften – ob nun in Amerika, Israel oder anderswo auf der Welt – sind politisch ebenso heterogen wie andere Gruppen, die durch eine gemeinsame Geschichte, ethnische Herkunft, Kultur oder Religion verbunden sind. Wer hätte das Recht, ihnen Vorschriften zu machen? Aber darum ging es Kristol nicht. Er wollte überzeugen, und seine Botschaft ist für andere Gemeinschaften ebenso wertvoll wie für die jüdische: Es ist wichtig, sich von Idealen aus einem vergangenen Kontext nicht den Blick auf die eigenen Interessen verstellen zu lassen. Das ist heute nicht weniger richtig als in den 80er-Jahren, nicht zuletzt für die Juden weltweit. Auch Kristols Schlussfolgerung scheint noch immer – oder wieder? – richtig zu sein.
»Juden zählen nicht«
»Juden zählen nicht«, hat Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, angesichts der antisemitischen Äußerungen bei der Berlinale-Preisverleihung im Februar in dieser Zeitung geschrieben. Dieser Eindruck drängt sich auf. Noch zutreffender wäre es zu sagen, Juden zählten nicht für die politische Linke. Denn auf der Linken stehen sowohl die Kulturschaffenden, die Schuster meinte, als auch die Kulturstaatsministerin, die es kaum über sich brachte, den Vorfall zu verurteilen.
Aus der Behörde von Claudia Roth stammt zudem das »Rahmenkonzept Erinnerungskultur«, von dem man befürchten muss, dass es zu einer Marginalisierung der Holocaust-Erinnerung führen würde. Und schließlich ist der Antisemitismusskandal auf der documenta fifteen, der ebenfalls mit Roths Namen verbunden ist, noch nicht vergessen.
Nur noch eine Minderheit der Demokraten findet es richtig, Israel zu unterstützen.
Natürlich gilt für die populistische bis extreme Rechte Ähnliches, woran Schuster mit einem Verweis auf Martin Walsers Paulskirchenrede von 1998 erinnert hat. Aber die politische Linke sticht schon aufgrund ihres internationalen Einflusses heraus. Antisemitische und israelfeindliche Einstellungen von links sind an den amerikanischen Elite-Universitäten ebenso zu Hause wie in vielen linken, sogar gemäßigt linken Parteien. Und linke Parteien, denen man keinen Antisemitismus attestieren kann, darf man doch unterstellen, dass sie dem Staat Israel nicht gerade mit Sympathie gegenüberstehen.
Die politischen Veränderungen, die Kristol in den 80er-Jahren in den Vereinigten Staaten beobachtete, lassen sich heute fast überall in der westlichen Welt feststellen – Irland ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. In Spanien zum Beispiel hat die gemäßigte Rechte den traditionellen, aus der katholischen Tradition stammenden Antisemitismus längst abgelegt. Sie steht Israel mit Verständnis gegenüber, während die politische Linke alles andere als frei von einem israelbezogenen Antisemitismus ist. In Frankreich lässt sich Ähnliches beobachten.
Gegen Israel und sein Recht auf Selbstverteidigung
Auch in Amerika hat sich die von Kristol beschriebene Entwicklung fortgesetzt. Aktuellen Umfragen zufolge glaubt nur noch eine Minderheit der Demokraten daran, dass es moralisch richtig und im amerikanischen Interesse sei, Israel zu unterstützen. Bei den Republikanern ist es genau umgekehrt. Vor allem junge linke Demokraten, die die Zukunft der Partei sind, beziehen Stellung gegen Israel und sein Recht auf Selbstverteidigung.
Was berechtigt also zu der Hoffnung, dass Joe Biden den linken Flügel nach seiner eventuellen Wiederwahl weiter unter Kontrolle halten kann? Wer das nicht für möglich hält, müsste den republikanischen Kandidaten wählen, wäre der nicht Donald Trump. Die Radikalisierung der Republikaner, ihre Haltung zur Ukraine und vor allem ihr Präsidentschaftskandidat selbst lassen es nicht zu, sie als die vernünftige Alternative zu sehen, die Irving Kristol den amerikanischen Juden ans Herz legte.
Sein eigener Sohn, der Journalist William Kristol, ist nicht ohne Grund einer der prominentesten »Never Trumpers«. Er weiß, dass im heutigen Amerika nicht nur die Juden, sondern auch die authentischen Konservativen heimatlos geworden sind. Das ist ein neues, größeres Dilemma, das selbst Irving Kristol nicht auflösen könnte, wenn er noch leben würde.
Der Autor ist stellvertretender Leiter Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische Politik und Leiter Zeitgeschichte der Konrad-Adenauer-Stiftung.