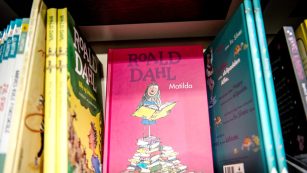Richard Guindi steht an der Kreuzung von der 7. Avenida und der 13. Calle in Guatemala-Stadt. Der schlanke Mann mit dem krausen silbrig grauen Haarschopf geht auf und ab. Er wartet vor dem Eingang der Synagoge Shaarei Binyamin und hält Ausschau. Guindi ist 57 und Präsident der jüdischen Gemeinde von Guatemala-Stadt. Er öffnet die gepanzerte Tür zum Eingang.
»Ein Spezialist aus Israel überprüft gerade unsere Sicherheitssysteme, denn Guatemala ist ein gefährliches Land«, sagt Guindi und hebt entschuldigend die Arme. »Aber hier ändert sich gerade vieles – vielleicht zum Guten.« Er geht voran in den Innenhof, der die Synagoge umschließt.
Kuppel Von der Architektur der Synagoge ist von außen nur die aufwendige, an ein spitz zulaufendes Zelt erinnernde Dachkonstruktion zu sehen. Im Zentrum der ungewöhnlichen Konstruktion aus den 60er-Jahren befindet sich die geräumige Kuppel, unter der einige Hundert Beter Platz haben.
»Unsere Gemeinde besteht aus 165 Familien, wir sind knapp 800 Mitglieder und können uns durchaus das Zentrum jüdischen Lebens in Guatemala nennen«, sagt Guindi. Nicht nur die markante Synagoge, sondern auch der koschere Supermarkt, der weitläufige Verwaltungstrakt und der Kindergarten gehören zum Gemeindezentrum.
Als es eröffnet wurde, war Guindi ein Jugendlicher und lebte in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Dort ist er aufgewachsen, seine Eltern hatten sich da kennengelernt. Die Mutter stammt aus Kairo, die familiären Wurzeln des Vaters liegen im syrischen Aleppo. Angesichts von Pogromen, Diskriminierung und fehlenden Perspektiven gingen die Guindis nach Lateinamerika. »Mein Großvater war Oberrabbiner der legendären jüdischen Gemeinde von Aleppo – aber er sah keine Chance mehr in Syrien«, erinnert sich sein Enkel und lässt ein bitteres Lächeln um die Lippen spielen.
Mit 17 Jahren ging Guindi zum Studium in die USA und ließ sich zum Ingenieur und Lichttechniker ausbilden. Damit verdient er heute sein Geld in Guatemala-Stadt. Doch die Bedingungen sind alles andere als einfach. Aufschläge, doppelte Buchführung und manipulierte Rechnungen, um Schwarzgeld zu generieren und die Behörden hinters Licht zu führen, sind Usus in Guatemala. »Es ist ein Volkssport der Besserverdienenden, die Regierung um Steuern zu prellen oder kräftig zur Kasse zu bitten«, kritisiert der Unternehmer. »Korruption gehört in Guatemala schon lange zum Alltag. Doch die letzte Regierung hat jeden Rahmen gesprengt«, schildert er die Gründe, aus denen sich die Ereignisse im August und September 2015 überschlugen.
protest 150.000 Menschen gingen Ende August auf die Straße, um gegen Korruption und Vetternwirtschaft im Präsidentenpalast zu protestieren. Dabei – und das war neu – standen Militärs neben Bauern, Studenten und Unternehmern. Zudem hatten sich die friedlichen und kreativen Demonstrationen auf das ganze Land ausgeweitet.
»Der Regierung wurde öffentlich jedes Vertrauen entzogen«, erzählt Guindi. Das Fass zum Überlaufen brachte schließlich die Tatsache, dass selbst Geld für die medizinische Behandlung und für Medikamente nicht mehr zur Verfügung stand. Handfeste Beweise für das korrupte Agieren der Regierung sammelte eine Kommission der Vereinten Nationen. Sie konnte belegen, dass die organisierte Kriminalität die Regierungsstrukturen in Guatemala fest im Griff hatte.
Dass diese Beweise vergangenes Jahr letztendlich publik gemacht wurden, sei ein Einschnitt in der Geschichte des Landes gewesen, meint Guindi, der seit seinem 22. Lebensjahr in Guatemala lebt. In seinen Augen war das politische System zu einer »Maschine der Selbstbereicherung« verkommen. »Im Parlament wurden Geldkoffer hin- und hergeschoben, um neue Parlamentarier in das korrupte System zu involvieren«, erzählt Guindi. Immer wieder sei zu hören, dass diejenigen, die nicht mitmachen wollten, massiv bedroht wurden.
Doch während der öffentlichen Proteste zwischen April und September 2015 organisierten sich neue zivile Gruppen, und am 2. September sah sich Präsident Otto Pérez Molina durch den Druck der Straße gezwungen zurückzutreten.
Der Präsident, ein Ex-General, war nicht mehr zu halten, nachdem am 26. August mehr als 100.000 Menschen in Guatemala-Stadt auf die Straßen gegangen waren und Abertausende in allen größeren Städten des Landes ihrem Beispiel folgten. Straßen wurden blockiert, ganz Guatemala befand sich im Aufstand gegen die Korruption. Seitdem spürt man eine Aufbruchstimmung im Land, die sich besonders nach den beiden Präsidentschaftswahlgängen im Herbst bemerkbar macht.
Kontrolle »Fiscalizar« (übersetzt so viel wie »überprüfen« oder auch »kontrollieren«), ist derzeit eines der am häufigsten benutzten Wörter in Guatemala. Es bedeutet, dass die Wähler ihren Abgeordneten auf die Finger schauen wollen. Das sei gar nicht schwer, argumentieren Journalisten wie Martín Rodríguez Pellecer vom Online-Magazin »Nómada«.
Über neue Initiativen aus dem Mediensektor, wo es gleich mehrere qualitativ gute Alternativen gibt wie »Contrapoder« oder »Plaza Pública«, freut sich auch Guindi. »Wir haben die Chance, etwas zu verändern«, sagt er und winkt seiner Frau und seiner Tochter zu, die gerade den koscheren Supermarkt auf dem Weg ins Büro passieren. Die eine arbeitet für die Verwaltung des Zentrums, die Jüngere organisiert bei Makkabi Sportveranstaltungen.
Auf den Supermarkt ist die Gemeinde besonders stolz, denn hier gibt es Produkte, die im Rest des Landes kaum zu bekommen sind. »Selbst in Quetzaltenango oder Antigua«, sagt Guindi und weist stolz den Weg durch die Regale, wo sich koschere Schokoladenchips und Croutons genauso finden wie Orangensaft und Wein.
In Quetzaltenango, auch kurz Xela genannt, begann Ende des 18. Jahrhunderts die jüdische Geschichte Guatemalas. Dort steht auch heute noch eine Synagoge. In Antigua, Guatemalas Tourismusmagnet, gibt es eine weitere Synagoge, weitere zwei Synagogen stehen in Guatemalas Hauptstadt. Dort gibt es die aschkenasische Synagoge Shaarei Binyamin und die sefardische Maguen David. Letztere befindet sich im Zentrum der Altstadt, dort, wo im Januar der Prozess gegen Ex-Präsident Otto Pérez Molina begann. Dass sich ein Präsident wegen Korruption im eigenen Land verantworten muss, ist ein Novum in Guatemala. »Aber extrem wichtig, um den Weg für die Erneuerung des Systems zu schaffen«, so Guindi.
Ob das die Mehrheit in der Gemeinde so sieht, will er nicht behaupten, und eigentlich wollte er gar nicht so viel über Politik reden. Aber die Situation sei nun einmal so brisant, dass man kaum anders könne, sagt er schulterzuckend und weist den Weg nach oben in den Kindergarten. Dort sind 120 Kinder angemeldet, davon 20 jüdische, die von zahlreichen Erziehern betreut werden und auf einer nicht einsehbaren Dachterrasse spielen.
Sponsoren Für einen Teil der Baukosten des Zentrums sind private Spender aufgekommen, darunter bekannte Gemeindemitglieder wie Thomas Rybar. Dessen Eltern flohen vor dem Holocaust und bauten mit Guateplast ein florierendes Kunststoffunternehmen auf. Auch andere in Guatemala bekannte Persönlichkeiten hat die rund 1200 Mitglieder zählende Gemeinde hervorgebracht, darunter Ärzte und Rechtsanwälte sowie die Textilunternehmer-Familie Habie.
»In der Politik gibt es jedoch relativ wenige jüdische Spuren, und das ist gut so«, meint Richard Guindi. Dann weist er den Weg nach unten. Ob der neue konservative Präsident Jimmy Morales, der im Januar vereidigt wurde, wie angekündigt, langfristig gegen die Korruption vorgehen wird, will Guindi nicht prophezeien. Aber er hofft es. Dann öffnet er die schwere Metalltür zur Straße hin und lächelt optimistisch.