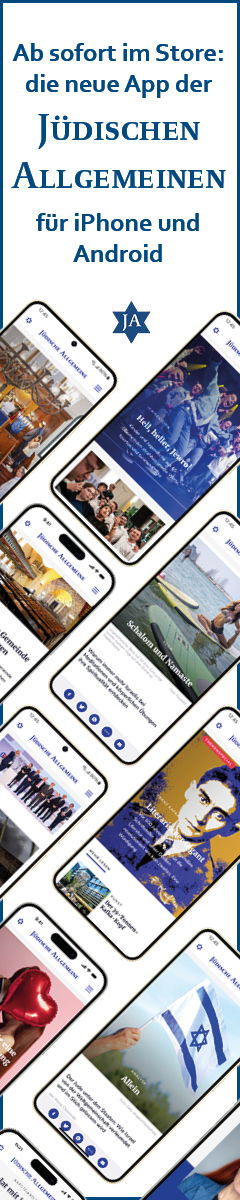Im Talmud steht, dass 40 Tage vor der Geburt eines Sohnes eine Stimme vom Himmel verkündet, wessen Tochter er später heiraten wird. Im Jiddischen gibt es für diesen göttlich vorbestimmten Lebenspartner das Wort »Bashert«. Doch die Suche nach der »von Gott bescherten« anderen Hälfte der Seele gestaltet sich oft langwierig und mühsam. Speziell wenn der oder die Zukünftige Hunderte Kilometer weit entfernt voneinander geboren werden. Hier kommt Sara Kofmann ins Spiel.
Rückblende 1997. Im Durchgangslager Unna-Massen klettert die damals 21-Jährige mit ihren Eltern und der Oma aus dem Bus. Wenige Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben sie ihre lettische Heimat Riga hinter sich gelassen, um in Deutschland neu anzufangen.
Die Aussichten der jüdischen Zuwanderer sind zum Teil gar nicht so schlecht: Sara spricht schon ein bisschen Deutsch und bringt einen Bachelor-Abschluss in Computer Science mit. An der Fachhochschule Dortmund vertieft sie ihre Kenntnisse und absolviert in der Regelstudienzeit ein Studium zur Diplom-Informatikerin. Die Familie verteilt sich über das Rheinland.
Sara findet bald Job und Wohnung in Düsseldorf. Das jüdische Erbe ist zu diesem Zeitpunkt in erster Linie eine alte Familientradition, die vor allem von der Großmutter hochgehalten wird. Und vom Bashert ist erst einmal lange nichts zu sehen.
DATING-SEITE Das ändert sich mit Saras 30. Lebensjahr. Auf einer jüdischen Dating-Seite trifft sie eher zufällig den gleichaltrigen Stanislav Kofmann. Man telefoniert, verabredet sich. Das erste Treffen zwischen der Softwarespezialistin und dem Steuerberater dauert zwei Stunden – und das Schicksal nimmt seinen Lauf. »Es war Liebe auf den ersten Blick«, schwärmt die 44-Jährige heute. Göttlicher Beistand habe da sicher mitgewirkt: »Da war die Hand von Haschem im Spiel.«
Zwei Seelenhälften hatten sich gefunden. Mit 80 Gästen feiert man bereits sechs Monate später Hochzeit im Düsseldorfer Yachtclub, direkt am Rhein, mit koscherem Essen.
Das frisch vermählte Paar zieht nach Krefeld. Ein Jahr später kommt Tochter Yael Miriam zur Welt. Die Eheleute lernen hier auch den Krefelder Rabbiner Yitzhak Mendel Wagner kennen und schätzen.
An ihrem säkularen Lebensstil kommen ihnen erste Zweifel, als sie zu einer Gruppe anderer junger jüdischer Paare stoßen. Viel wird über die Frage geredet, wie man jüdische Traditionen im Alltag am Niederrhein leben kann – und wie sich das anfühlt.
Die Eheleute sind auch in puncto Religion ein Team.
In dieser Zeit entdeckt Stanislav seine jüdische Identität neu. Er achtet darauf, die Mizwot einzuhalten, zieht daraus neue Kraft. »Mein Mann ist anders geworden, besser«, sagt Sara anerkennend im Rückblick. Nun steht die Java-Entwicklerin vor der Frage, wie es mit ihrem Leben weitergehen soll.
Die Entscheidung fällt ihr leicht. Sie folgt ihrem Mann, sie bleiben auch in Sachen Religion ein Team: »Wir haben unser Leben komplett umgestellt.«
SCHIDDUCH Zu anderen religiösen Familien entwickeln sich Freundschaften. Saras Kommunikationsfähigkeiten sprechen sich in der kleinen Gemeinde schnell herum.
Vor zwei Jahren kommt ein Freund darauf zurück. Der Mann, religiös und frisch geschieden, möchte wieder heiraten. Er bittet Sara Kofmann um Unterstützung: »Hilf mir, du kennst doch viele Leute.« Die Informatikerin bespricht das mit einer Freundin, die eine Frau kennt, die zufällig selbst gerade auf der Suche ist und sich eine Beziehung auf Grundlage der jüdischen Traditionen gut vorstellen kann.
Saras Kommunikationsfähigkeiten sprachen sich in der kleinen Gemeinde schnell herum.
»Das könnte passen«, meinte die Freundin. Sie sollte recht behalten. Als Sara Kofmann die Frau kontaktiert und ihr den Freund beschreibt, kommt etwas in Gang: »Sie war begeistert.« Die beiden Suchenden lernen sich kennen und lieben. Sara Kofmann hilft bei den Hochzeitsvorbereitungen und ist schließlich stolzer Gast der Zeremonie.
»Es hat mir großen Spaß gemacht«, sagt sie. Ohne groß darüber nachzudenken, hatte die Lettin ihren ersten Schidduch erfolgreich beendet. Das hebräische Wort bedeutet »vorstellen«, »einführen«, »verhandeln«. Es ist ein Arrangement, bei dem zwei Juden einander vorgestellt werden, in der Hoffnung, dass sie ein »Beit Neeman BeYisrael«, ein »ewiges jüdisches Haus«, also eine Familie gründen.
HOBBY Der Bräutigam macht bei der Feier keinen Hehl daraus, wie er seine Frau durch Vermittlung von Sara Kofmann kennengelernt hat. Die Geschichte macht bei am Niederrhein die Runde. Bei Sara Kofmann klingelt in den folgenden Wochen häufiger das Telefon, weitere Suchende melden sich. Die Nachfrage nach jüdischen Ehepartnern erweist sich als enorm. Was tun?
Wieder steht sie vor einer grundsätzlichen Frage: Ist es mit ihren religiösen Grundsätzen vereinbar, Menschen zusammenzubringen, die eventuell nicht religiös sind? Schließlich gilt die Ehe im Judentum als heilige Institution. Dating einfach nur aus Spaß ist im Talmud nicht vorgesehen. Mit der Stimme, die von oben den Namen der Ehepartnerin verkündet, will sie es sich nicht verscherzen.
Sara Kofmann fragt ihren Rabbiner um Rat. Dessen Antwort weist ihr den Weg: Aus seiner Sicht ist die ehrenamtliche Ehevermittlung für jüdische Singles dann erlaubt, wenn beide Partner übereinkommen, in einer Ehe die Ge- und Verbote einhalten zu wollen. »Das ist das Rezept einer guten Ehe«, meint der lebenserfahrene Rabbi.
Nicht der schnellste Weg zur Chuppa ist das Ziel, sondern eine stabile Ehe auf religiöser Grundlage.
Die Informatikerin ist erleichtert. Sie kann das Schadchanut, das »Matchmaking«, jetzt mit gutem Gewissen zu ihrem Hobby machen und geht es systematisch an. Ihr Werkzeug: Handy, Headset, Tabellen, Fragebögen – und Menschenkenntnis. »Ich muss schon einen guten Eindruck von der Person haben, die ich zu vermitteln versuche. Sonst wird es einfach nicht gelingen. Ich muss auch ein gutes Gewissen dabei haben«, betont die heute 44-Jährige.
FRAGEBOGEN Wer zu ihr kommt, füllt zunächst einen Fragebogen aus: Darin geht es um Geburtsort, Erziehung, den Beruf und die Frage, wie man es denn mit der Religion hält. Welche Mizwot werden eingehalten? Wird koscher gekocht? Sie vermittelt nur Menschen, die versuchen wollen, sich nach den Ge- und Verboten zu richten.
Vor allem kümmert sich die gebürtige Lettin um russischsprachige Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Meist sind es Männer, die eine jüdische Familie gründen wollen, die aber selbst nicht aus einer solchen stammen. Häufig sind die Kandidaten über 40 und können sich mit Dating-Plattformen nicht so richtig anfreunden. »Diese Gruppe hat es oft schwer, in der jüdischen Community passende Partnerinnen zu finden. Es ist wirklich ein großer Bedarf da.«
Auch seien die Zuwanderer offen für die Dienste einer Vermittlerin. Das könnte auch historische Gründe haben: Aus der jüdischen Diaspora in Osteuropa waren Schadchanim (Schadchen) schließlich jahrhundertelang nicht wegzudenken. In streng religiösen Kreisen kommen Schidduchim heute noch ausschließlich durch einen Vermittler zustande, sagt Sara Kofmann. Es können professionelle Schadchanim sein, aber auch Rabbiner, Freunde und Verwandte.
FEEDBACK »Natürlich kann ich nicht jedem helfen«, unterstreicht die ehrenamtliche Vermittlerin. Wenn die Daten einmal komplett sind, macht sich Sara Kofmann auf die Suche, durchforstet ihre Listen und Dating-Seiten und spricht mit anderen Vermittlerinnen – immer auf der Suche nach dem passenden Gegenstück, auch international. Wenn sie einen potenziellen Partner oder eine mögliche Partnerin gefunden hat, tauscht sie die jeweiligen Informationen zwischen den Suchenden aus und arrangiert – wenn beide zustimmen – einen ersten direkten Kontakt.
Hat es gefunkt? Ist von beiden Seiten ein reales Treffen gewünscht, oder soll erst weiter telefoniert werden?
Sara Kofmann empfiehlt, den ersten telefonischen Kontakt kurz zu halten. »15 bis 20 Minuten reichen für das erste Gespräch.« Ein paar solcher Gespräche seien zu Anfang schon empfehlenswert. Dann wird Rücksprache mit der Schadchanit gehalten. Hat es gefunkt? Ist von beiden Seiten ein reales Treffen gewünscht, oder soll erst weiter telefoniert werden?
Entscheidend ist aus ihrer Sicht der Umgang mit Absagen. Auf keinen Fall würde sie versuchen, eine Kandidatin zu überreden: »Nein heißt nein.« Natürlich gibt es auch schon einmal unfreundliche Worte, wenn es nur von einer Seite her passt. »Ich bin froh, dass ich in diesem Moment dazwischen bin. Es ist gut, wenn ich das abbekomme – und nicht die andere Person.« Die Kandidaten erhalten ein Feedback der Schadchanit.
MISSERFOLGE Dazu kann auch der Hinweis gehören, vielleicht die Suchkriterien noch einmal zu überdenken und zum Beispiel eher nach einer etwa gleichaltrigen künftigen Partnerin zu suchen als nach einer deutlich jüngeren: »Mein oberstes Gebot ist: Ich möchte die Menschen mit dem, was ich sage, nicht verletzen. Misserfolge sind dazu da, dass man daraus lernt.«
Für die Suchenden ist die Kontaktaufnahme ähnlich wie ein Bewerbungsgespräch.
Für die Suchenden sei die Kontaktaufnahme ähnlich wie ein Bewerbungsgespräch. Tipp der Schadchanit: Natürlich bleiben, nicht versuchen, eine Rolle zu spielen. Wenn gegenseitiges Interesse da ist, sollte schnell ein reales Treffen folgen.
»Vorher noch drei, vier Monate zu telefonieren, macht nur in Corona-Zeiten Sinn.« Zur Verlobung rät sie jedoch nur, wenn sich die beiden schon gut kennen und die wichtigen Fragen geklärt sind.
Ein weiterer Tipp von Sara Kofmann: »Man sollte Personen anrufen, die den Kandidaten gut kennen. Das ist ein extrem wichtiger Teil eines Schidduch.« Die Angabe solcher Referenzpersonen ist Teil der Fragebögen.
Wobei ihr Ziel nicht der möglichst schnelle Weg zur Chuppa ist, sondern eine stabile Ehe auf religiöser Grundlage und ohne unangenehme Überraschungen nach der Eheschließung: »Ich will schließlich das Glück bringen.«
CORONA Fünf erfolgreiche Schidduchim konnte die Schadchanit in den vergangenen zwei Jahren so schon stiften. Mit mehreren weiteren Paaren ist sie in Kontakt. Neue Schidduch-Versuche will sie erst starten, wenn sie wieder Wartende vermitteln konnte. Es soll schließlich ein Hobby bleiben und kein Vollzeit-Ehrenamt. Gern hat sie auch bei der Organisation traditionell jüdischer Hochzeiten mit all ihren speziellen Gebräuchen geholfen.
Die realen Treffen zu organisieren, erweist sich in Zeiten von Reisebeschränkungen als kompliziert.
Corona hat ihre Leidenschaft fürs Eheanbahnen schwieriger gemacht. Die realen Treffen zu organisieren, erweist sich in Zeiten von Reisebeschränkungen als kompliziert – speziell dann, wenn die potenziellen Partner auf verschiedenen Kontinenten leben. Doch auch hier gibt es Lösungen. Eine junge Israelin und ihr möglicher Partner aus Deutschland – beide mit russischem Hintergrund – planen gerade ein erstes Treffen in der Ukraine.
Dafür würde die junge Frau die obligatorische zweiwöchige Quarantäne nach ihrer Rückkehr gern in Kauf nehmen. »Die Anfragen sind in der Corona-Zeit gestiegen«, bemerkt Sara Kofmann. »Offenbar ist vielen Alleinlebenden bewusst geworden, dass ihnen jemand fehlt.« Die Suche nach der Person, deren Identität 40 Tage vor der Geburt himmlischerseits verkündet wurde, ist bei vielen jüdischen Singles offenbar gerade drängender denn je.