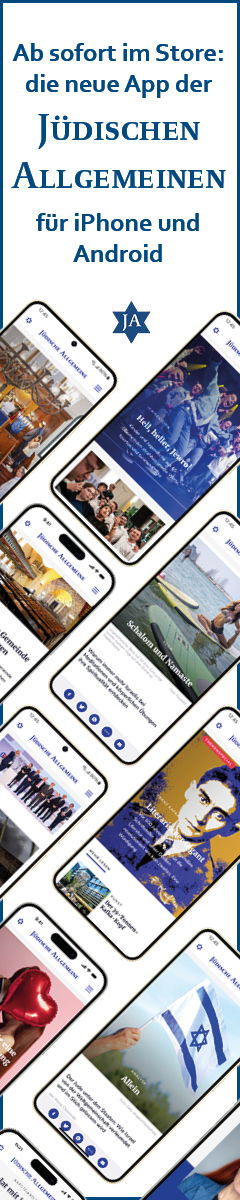»Diordiza-Straße, Jüdisches Zentrum«, brummt der Taxifahrer in sein Funkgerät und startet den Wagen. Der alte VW zieht kurz an, dann stottert er, und schließlich macht er keinen Mucks mehr. Leise rollt er den Berg hinunter. Kurz vor dem Ende springt er doch noch an, und damit alles wieder ordentlich ins Laufen kommt, drückt der Fahrer aufs Gas. Der Wagen brettert durch das Stadtzentrum und hält in einer Seitenstraße zwischen zwei Gebäuden, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Der Bau rechts strahlt wie weißer Marmor, davor patrouillieren Uniformierte. Gegenüber auf der anderen Straßenseite steht ein grauer Wohnblock. »Dann ist das Jüdische Zentrum wohl dort.« Der Fahrer deutet auf ein Schild »Jüdische Bibliothek ›Itzik Manger‹«.
In einem Büro sitzt Olga Sivac und winkt ab »Das Jüdische Zentrum liegt gegenüber. Dort wo die Uniformierten stehen.« Dann nimmt sie ein paar Bücher und geht auf den Flur. Olga ist die Leiterin der Fremdsprachenabteilung, sie ist Mitte 50 und trägt ihr Haar kurz. Lange lebte sie in Israel, aber sie kam nach Chisinau zurück, auch wegen der jüdischen Bibliothek. Als Olga die Tür zu ihrem Büro abschließt, sagt sie: »Wir sind das jüdische Kulturzentrum – nicht das Jüdische Zentrum.« In der Straße gebe es zwei jüdische Einrichtungen, beide hätten aber wenig miteinander zu tun.
Olga schaut kurz in den Ballettsaal. Ein paar Mädchen tanzen, doch sie schieben die Tür gleich wieder zu. »Die wollen keine Zuschauer«, sagt Olga und lacht. Der Ballettsaal heiße »Die Quelle« und solle daran erinnern, dass in der Bibliothek vor 20 Jahren wieder das jüdische Leben in Chisinau begann.
wasserflecke Aus dem nächsten Raum riecht es feucht und faulig. Olga schaut kurz hinein, drinnen steht das Fenster offen, an der Decke zeichnen sich Wasserflecke ab. »Wir haben Probleme mit den Übermietern«, sagt sie. An allen vier Wänden stehen Bücherregale – es ist die jiddische Sammlung der Bibliothek. Am Tisch sitzt eine ältere Dame mit weißem Haar und einer Lesebrille. Die 82-jährige Sarah Shpitalnik-Molchanskaya kommt jede Woche zwei-, dreimal vorbei und kümmert sich um die Bücher. Sie ist eine von drei Leuten in der Stadt, die noch Jiddisch sprechen.
Als Olga später wieder an ihrem Schreibtisch sitzt, erklärt sie, warum es in der Straße zwei jüdische Zentren gibt. Das eine sei die Bibliothek, das sogenannte jüdische Kulturzentrum. Das werde von der Stadt bezahlt, sagt sie. Gegenüber auf der anderen Straßenseite, befindet sich seit fünf Jahren »Kedem«, das Jüdische Zentrum. Das werde vom American Jewish Joint Distribution Committee finanziert, der weltweit tätigen jüdischen Hilfsorganisation. In der Diordiza-Straße gebe es alles Jüdische doppelt: zwei Kinder- und Jugendprogramme, zwei Computerklubs und auch zwei Museen.
Gestrüpp Am nächsten Morgen schneiden sich ein paar Jungen mit einer Heckenschere durch mannshohes Gestrüpp. Sie stehen auf dem jüdischen Friedhof von Leova, 100 Kilometer südlich von Chisinau. Der Himmel ist grau und es nieselt, Raben krächzen von den Bäumen. Die Jungs sind so etwas wie ein Vortrupp, sie sollen den Weg für die anderen bahnen. Hinter ihnen schleppen ein paar Jugendliche bündelweise Unkraut fort, eine Gruppe zieht Mülltüten voller Glasflaschen aus dem Gebüsch. Insgesamt sind es rund 40 Jugendliche, sie gehören zum Jugendklub von »Kedem«, dem jüdischen Zentrum gegenüber der Bibliothek.
Als der Vortrupp ein Stück Dickicht aufgerissen hat, balancieren ein paar Jungs zwischen den Grabsteinen weiter. Ganz vorn geht Ohad Sternberg. Der Amerikaner arbeitet als Freiwilliger für das US-Friedenscorps und hilft dem Jugendklub. Er ist Ende 20, kräftig gebaut und trägt eine knallrote Windjacke. Plötzlich bleibt er stehen und schaut zum Boden. Vor ihm liegt ein Grabstein. Die Jungs reißen das Gras weg, raspeln den Dreck fort, und Ohad liest den hebräischen Text vor: »Hier liegt ein Paar, das von Dieben ermordet wurde, als die beiden noch jung waren.«
Dickicht Der Stein ist besonders groß. Ohad ruft über den Friedhof, ob jüdische Jugendliche in der Nähe seien. Nichtjuden dürfen den Stein nicht aufrichten. Schließlich stemmen sie ihn zu siebt auf den Sockel. Derweil kehren die anderen aus dem Dickicht zurück. Es wird lange dauern, hier Ordnung zu schaffen. Das Gelände hat die Größe von zwei Fußballfeldern und ist komplett zugewachsen. Es wirkt, als habe sich ein Urwald darüber geschlossen.
Nun reißen sie am Eingang Gras und Sträucher von den Gräbern. Ein Mann mit Schnurrbart und Schiebermütze fotografiert sie dabei. Er ist Journalist bei der örtlichen Zeitung »Curierul de Leova« und heißt Ion Mititelu. Er wohnt schon lange im Ort und kann sich gut an die Zeit erinnern, als Juden noch hier lebten. Fast alle von ihnen seien Anfang der 90er-Jahre ausgewandert, erzählt er. Heute gibt es nur noch eine jüdische Familie in Leova und eine andere in einem nahegelegenen Dorf. Mititelu zeigt auf einen Grabstein: »Dort liegt ein Kollege von mir, er war auch Journalist.« Seit die Juden weggegangen sind, hat er das Gefühl, hier fehle etwas, sagt er.
Auch heute tragen sich etliche der rund 25.000 Juden im Land mit dem Gedanken, nach Israel oder in die USA auszuwandern. So mancher Gemeindevertreter spricht gar von einer Ausreisewelle. Grund sei die Wirtschaftskrise, von der Moldawien besonders hart getroffen wurde, und auch die schwere Regierungskrise. Dass die vorgezogenen Parlamentswahlen am Sonntag daran etwas ändern werden, bezweifeln viele.
Jugendklub Auf der Rückfahrt im Bus verteilt der Leiter des Kedem-Jugendklubs, Kolja Railean, heißen Kaffee. Er ist Ende 20, groß und schlank, die Haare stecken unter einem schmalen Reifen. »Der Jugendklub will die Freiwilligenarbeit fördern, deshalb sind wir heute zu dem Friedhof gefahren«, sagt er. Während er erzählt, setzen sich immer wieder Jugendliche neben ihn, die Mädchen umarmen ihn. Sonst sei der Jugendklub aber nur in Chisinau tätig. Bei Kedem seien noch andere Projekte der jüdischen Gemeinde untergebracht, sagt Railean. Vor allem gäbe es viele gemeinnützige Programme. Allein das Hesed-Yehuda-Zentrum betreue Hunderte alte Menschen. Rund 2.000 von ihnen bekämen Geld, um Lebensmittel einkaufen zu können.
Am späten Nachmittag kommt der Bus mit den Jugendlichen wieder in Chisinau an und hält in der Diordiza-Straße zwischen den beiden jüdischen Zentren. Unweit der Straße liegt die von Chabad betriebene Synagoge. Dort sitzt Zalman Abelsky in Strickjacke am Schreibtisch und liest einen Brief. Der 82-Jährige ist der Rabbiner von Moldawien. Ein ruhiger, aufmerksamer Mann mit weißem Vollbart.
Rab Zalman, wie sie ihn hier nennen, hat schon zu Sowjetzeiten in Chisinau gelebt. Seine Synagoge sei auch damals nicht geschlossen worden, erzählen die Leute. »Aber das war nur eine Attrappe. In der Synagoge gab es kein wirkliches jüdisches Leben«, sagt Rab Zalman. Er selbst sei damals Mitglied einer Studentengruppe gewesen, die sich heimlich in verschiedenen Kellern der Stadt traf. Ziel sei es gewesen, zu verhindern, dass das religiöse Leben stirbt. Vor 20 Jahren sei die Synagoge dann offiziell wiedereröffnet worden.
Gebet Während der Rabbi erzählt, treffen sich vor dem Fenster ein paar Gemeindemitglieder, sie kommen zum Abendgebet. Hinter ihnen zeichnen sich Höfe, Verschläge und Schuppen ab. Die Gegend erinnert an die alten Schtetl. »Die meisten Gemeindemitglieder interessieren sich erst seit dem Ende des Kommunismus wieder für ihre jüdischen Wurzeln«, sagt Rab Zalman. Nun säßen Alte und Junge in der Synagoge und lernten Tora.
Später, zum Abendgebet, haben sich rund 30 Leute in der Synagoge eingefunden. Die meisten von ihnen sind über 60, dazwischen stehen ein paar amerikanische Gaststudenten und ein Achtjähriger. Er hat blonde Schläfenlocken und trägt eine grüne Cargohose. Viele Juden hätten noch »zu viel Sowjetunion« im Kopf, deshalb kämen sie nicht in die Synagoge, sagt eine Frau. Sie hoffe deshalb auf die Jugend. Dann, nach dem Abendgebet schlittert und rutscht der Achtjährige über das Parkett, seinem Vater hinterher. Die Zukunft der Chisinauer Juden liegt auf schmalen Schultern.