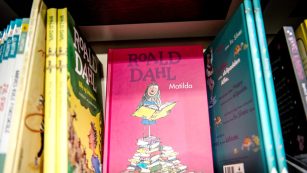Für jüdische Soldaten aus Frankreich und Deutschland, die ab Sommer 1914 aufeinander schossen, konnte die Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein: Deutsche Juden kämpften im Schützengraben um Anerkennung. Doch kein Einziger wurde über den niedrigsten Offiziersgrad hinaus – den Rang eines Leutnants – befördert. Auf französischer Seite hingegen kämpften zu Beginn des Ersten Weltkriegs acht jüdische Generale, 68 Majore und 150 weitere Offiziere. Rund 50.000 Juden, mehr als 20 Prozent der gesamten jüdischen Bevölkerung Frankreichs, taten bis 1918 Dienst in der Armee. In keinem anderen Land Europas waren Emanzipation und Integration so vollständig verwirklicht.
Frankreichs Juden waren, wie der Potsdamer Militärhistoriker Michael Berger schreibt, »Patrioten aus innerster Überzeugung, sie hatten Zugang zu den elitärsten Schulen und Universitäten des Landes, zu Laufbahnen als Staatsbeamte und Karrieren in der Armee«. Aber hatte nicht eben noch rassistisch geprägtes antisemitisches Geschrei das Land aufgewühlt?
komplott Der Name Dreyfus ist in Frankreich kaum verbreitet und wenn, dann vor allem im Elsass anzutreffen. So selten er sein mag – es ist ein Name, den man nicht vergisst und der für ein Komplott steht, das die Republik in eine Staatskrise stürzte. Alfred Dreyfus, Fabrikant und Offizier der Artillerie, wurde bezichtigt, für die Deutschen spioniert zu haben. Als Elsässer galt er als potenzieller Verräter französischer Interessen, als Jude war er ein willkommenes Opfer für die von Judenhass durchdrungenen konservativen Gesellschaftsschichten und der Armee. Das Offizierskorps wurde vom Adel dominiert, an leitenden militärischen Stellen saßen Männer, die monarchistisch oder nationalistisch gesinnt waren und die republikanische Regierung ablehnten.
Während der Verhandlung vor dem Obersten Kriegsgericht beteuerte Hauptmann Dreyfus seine Unschuld. Ein nach heutigen Maßstäben brutal offen skandierter Antisemitismus begleitete den Prozess. Ungerührt nahm Dreyfus die öffentlich inszenierte Degradierung hin. Man riss ihm die Schulterklappen ab, zerbrach seinen Offizierssäbel, warf den Verurteilten aus der Armee und verbannte ihn auf die Teufelsinsel vor der Küste von Französisch-Guayana. Theodor Herzl, seinerzeit Korrespondent in Paris, war Zeuge dieser Demütigung; er war dabei, als die Menge den Tod des Verräters und den Tod aller Juden forderte. Die Dreyfus-Affäre soll Herzl in seiner Zionismus-Idee bestärkt haben.
prozess Das war 1894. Noch während des Prozesses wurde ruchbar, dass Politik, Justiz und Militär Dreyfus geopfert hatten, um den wahren Landesverräter, Major Walsin-Esterházy, zu decken. Der Major, Spion im Auftrag des deutschen Kaiserreichs, wurde nie belangt. Indessen dauerte es zwölf Jahre, ehe man Dreyfus vollständig rehabilitierte. Die Armee holte ihn zurück, beförderte ihn zum Major und ernannte ihn zum Ritter der französischen Ehrenlegion.
Als 1914 der Krieg begann, lag die Affäre lange zurück, der Antisemitismus schien eingehegt. Alfred Dreyfus, mittlerweile 55 Jahre alt, als auch sein Sohn Pierre taten ihre soldatische Pflicht und kämpften fürs Vaterland, nahe Verdun und an der Somme. Dreyfus’ Neffe Émile und dessen Schwager Adolphe fielen noch im ersten Kriegsjahr.
Bereits vor dem Krieg hatten in Deutschland Nationalisten gegen den Zuzug von Juden gehetzt, die vor den Pogromen in Osteuropa flüchteten. Der verlorene Krieg stachelte den Judenhass weiter an. Derweil nahm Frankreich europaweit als einziges Land auch nach 1918 weiter jüdische Immigranten auf. Der Krieg hatte die soziale Stellung der Juden gestärkt.
Im Elsass, der Heimat von Alfred Dreyfus, blieb die Stimmung ambivalent. 1918 gab Straßburgs Oberrabbiner, ein gebürtiger Altelsässer, sein Amt auf. Er wollte beim Einzug der französischen Truppen keinen Gruß entbieten müssen.