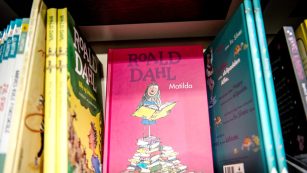»Vielleicht hört der Fußball jetzt überhaupt auf.« Das schrieb Franz Kafka 1923 aus Berlin an seinen Schwager Josef Pollak, den »lieben Pepa«. Es klingt nach einem typischen Kafka-Satz. Pessimistisch, schwermütig. Aber dass der Prager Schriftsteller, der damals in Berlin-Steglitz lebte, dem aufkommenden Fußballsport sein baldiges Ende prognostiziert hätte, ist eine Fehlinterpretation.
Vielmehr berichtete Kafka von seiner Lektüre der »Selbstwehr«, einer deutschsprachigen zionistischen Zeitung aus Prag. »Schlage übrigens die letzte Selbstwehr auf«, forderte er seinen Schwager auf, »Professor Vogel schreibt dort wieder gegen den Fußball, vielleicht hört der Fußball jetzt überhaupt auf.« Von Vogel stammten Beiträge wie »Der Kampf gegen die Fußballseuche«, aber die Redaktion beendete die von ihm losgetretene Debatte.
Vermutlich beschreibt Kafkas Satz also nur die Befürchtung, dass bald die von ihm geschätzte Zeitung nicht mehr über Fußball berichten könnte. Das wäre schlimm gewesen für Kafka, der sich stets für den DFC Prag interessiert und für Hakoah Wien begeistert hatte. Der DFC, Deutscher Fußball-Club Prag, war 1896 von Juden gegründet worden. 1900 wurde er Gründungsmitglied des Deutschen Fußball-Bundes, 1903 stand er im Finale um die Deutsche Meisterschaft, und noch in den 1920er-Jahren gehörte der DFC zu den besten Klubs in Europa.
Kafka war ein Fan des jüdischen Vereins Hakoah Wien
Noch besser stand Hakoah Wien da. Kafka war ein Fan des jüdischen Vereins, der 1925 österreichischer Meister wurde. Hakoah löste bei jungen Juden eine enorme Begeisterung aus. Nach einem Gastspiel in Berlin gegen Hertha BSC und Tennis Borussia gründeten Jugendliche 1924 den BK Hakoah Berlin, der schnell in die 1. Berliner Fußballliga aufstieg. Ob Franz Kafka in seiner Berliner Zeit ab und an zum Grunewaldsportplatz fuhr, um sich die Hakoah anzuschauen, ist unbekannt, aber unwahrscheinlich.
Den Bezirk Steglitz soll er selten verlassen haben. Ein unsportlicher Kauz war er jedoch nicht. Geschwommen ist er, was für ihn allerdings eine schwierige Sache war, wie er im Brief an den Vater schrieb: »Schon in der Kabine kam ich mir jämmerlich vor, und zwar nicht nur vor Dir, sondern vor der ganzen Welt.« In seiner Wohnung soll Kafka ab 1910 jedoch Übungen des damals populären dänischen Gymnastiklehrers Jørgen Peter Müller geturnt haben. Der empfahl in seinen Bestsellern, bei offenem Fenster die Beweglichkeit zu trainieren, »Müllern« nannte sich das.
Martin hat die berühmte Familie Kafka ein ganzes Stück sportlicher gemacht.
Gern pries Kafka die Wohltaten des Müllerns. An Felice Bauer schrieb er: »Ich werde Dir nächstens das ›System für Frauen‹ schicken, und Du wirst (denn Du hast es doch versprochen, nicht?) langsam, systematisch, vorsichtig, gründlich, täglich zu ›müllern‹ anfangen, mir darüber immer berichten und mir damit eine große Freude machen.«
Sport war in der weitverzweigten Familie Kafka nichts Ungewöhnliches. Franz’ Neffe Erich Kafka war sogar Fußballprofi. Viel ist über Erich leider bislang nicht bekannt. Geboren wurde er 1901 oder 1902 in Žatec. Er spielte für den DFC Prag, später wechselte er zu Teplice.
Tschechische Quellen berichten, er habe sogar zweimal für die deutsche Nationalmannschaft gespielt – das lässt sich aber in deutschen Unterlagen nicht bestätigen. Knieverletzungen sorgten für sein Karriereende, danach wurde er Handelsvertreter. Kurz nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei gelangte er nach České Tešín, eine Stadt im östlichen Tschechien. 1939 konnte er nach Lemberg fliehen, das damals auf dem Gebiet der Sowjetunion lag. Dort schlug er sich als Fabrikarbeiter durch.
1943 ging Erich in der Slowakei in den militärischen Widerstand und wurde von den Deutschen verhaftet. Später erzählte man sich, dass er von einem deutschen Soldaten, der früher gegen ihn Fußball gespielt hätte, gerettet worden wäre. Überprüfen lässt sich dies nicht, sicher aber ist: Erich Kafka erhielt von der Sowjetunion und von der Tschechoslowakei hohe Ehrungen.
Erichs Enkel Martin Kafka wurde 1978 geboren. Mittlerweile ist er Trainer der tschechischen Rugby-Nationalmannschaft, als Aktiver war er von 1999 bis 2006 in Spanien und Frankreich Rugby-Profi. 2002 gewann Kafka den europäischen Challenge Cup – das ist der zweite Europapokal, der im Rugby zu gewinnen ist, nicht ganz so wichtig wie der Champions Cup. Kafka wurde 2002 und 2003 zudem Punktbester der spanischen ersten Liga. Sein Karriereende beging er in Japan, beim Erstliga-
klub Sanix. Zu den ganz großen Stars dieses Sports zählte er nicht, aber zu den besten Rugbyspielern in Tschechien gehört er schon. 2007 wurde er Nationaltrainer, das ist er immer noch.
Entfernter Schriftsteller-Cousin
Auf seinen entfernten Schriftsteller-Cousin wird Martin oft angesprochen. »Wenn Sie etwas Kafkaeskes an mir suchen«, verriet er einmal lachend dem »Landesecho«, einem deutschsprachigen Magazin aus Tschechien, »nun, meine Mutter sagt immer, der Kafka in mir würde mich immer an allem zweifeln lassen.«
Dass er mit Franz Kafka verwandt ist, war ihm lange nicht bewusst. Als er 1990 mit seinem Rugby-Team nach Italien fuhr, sprach ihn dort ein Vereinspräsident an, woraufhin Martin sich bei seiner Familie erkundigte. Von da an wusste er, dass er die berühmte Familie Kafka ein ganzes Stück sportlicher gemacht hat.