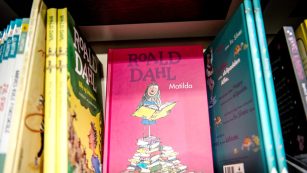Noch vor einigen Wochen hatte kaum jemand außerhalb Ungarns von Hódmezövásárhely gehört. Heute liest man den Namen dieser kleinen Stadt, die im Osten des Landes, nah an der rumänischen Grenze, liegt, in vielen internationalen Medien. Zu Recht – denn bei der Bürgermeisterwahl Ende Februar gewann in dieser Fidesz-Hochburg überraschend der gemeinsame Kandidat der Opposition.
Die Bedeutung dieses Ergebnisses könnte kaum überschätzt werden. Denn mit seinen knapp 50.000 Einwohnern gilt Hódmezövásárhely (auf Deutsch etwa »Marktplatz im Biberfeld«) als ein unterdurchschnittlich entwickelter, etwas trostloser und konservativer, aber im Grunde genommen ganz normaler Ort der ungarischen Provinz.
Wenn es der Opposition also gelungen ist, hier, außerhalb der großen urbanen Zentren, die rechtspopulistische Partei von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán zu besiegen, dann besteht für die Parlamentswahlen am 8. April doch noch Hoffnung.
klientelpolitik Die Nachricht von der überraschenden Niederlage der Fidesz schlug in der Budapester Innenstadt wie der Blitz ein. Denn seit vielen Jahren war eines der Hauptprobleme der linksliberalen Opposition genau dies: Außerhalb der Hauptstadt und in anderen Großstädten hatte sie so gut wie keine Chance, das Fidesz-Establishment vom Sockel zu stoßen.
Auch nicht in anderen Gegenden: im strukturstarken und exportorientierten Westen des Landes nicht, weil die Menschen dort im Großen und Ganzen mit ihrer Lebenssituation und damit auch mit Orbáns Wirtschaftspolitik recht zufrieden sind. Und im weniger entwickelten, landwirtschaftlich geprägten Osten nicht, weil dort die Fidesz-eigenen Klientel- und Abhängigkeitsverhältnisse besonders stark sind.
Den Mangel an ausländischen Investitionen in Orten wie Hódmezövásárhely kompensierte die Regierung durch einen reichlichen Zufluss von EU-Geldern, von denen zwar in erster Linie Orbáns Familie und Freunde profitiert haben, aber in geringerem Maße auch die normale Bevölkerung.
Vor diesem Hintergrund betonte die Propaganda der Regierungspartei stets den Kontrast zwischen der linksliberal geprägten, kosmopolitischen, »nicht wirklich ungarischen« Budapester Innenstadt und der patriotischen, christlichen, »echt ungarischen« Provinz.
George Soros Zwar vermied der Ministerpräsident selbst immer das Wort »jüdisch«, aber vor allem im Kontext der ständigen Hetzkampagne gegen den in Ungarn geborenen amerikanisch-jüdischen Milliardär George Soros dürften alle diese Botschaft verstanden haben: Die echten Söhne und Töchter der Nation wählen Fidesz, allen anderen wird unterstellt, aus irgendeinem Grund keine »echten Ungarn« zu sein. Und bis vor Kurzem schien die Opposition tatsächlich unfähig, aus der kleinen Blase der urbanen und liberalen Mittelschicht auszubrechen und die Mitte der ungarischen Gesellschaft zurückzuerobern.
Für die meisten Budapester Juden galt diese Erkenntnis der vergangenen acht Jahre Fidesz-Herrschaft als sicher, genauso wie für andere Minderheiten aus dem Hauptstadtmilieu, die sich mit dem Kurs der Regierung nicht identifizieren können, weil sie sich von den nationalistischen, rechtskonservativen oder illiberalen Elementen dieser Rhetorik bedroht fühlen.
Dies ist auch der Grund, warum junge Budapester Aktivisten wie Ádám Schönberger, einer der Gründer des alternativen jüdischen Kultur- und Gemeinschaftszentrums »Auróra«, stets für Bündnisse mit Initiativen anderer Minderheiten plädierten und sich – mangels echter politischer Perspektiven – lieber auf soziale und kulturelle Projekte konzentrierten.
Jobbik Hódmezövásárhely ändert jetzt das Spiel, stellt aber gleichzeitig die linksliberal Gesinnten vor ein sehr unangenehmes Dilemma. Denn der Sieg bei der dortigen Bürgermeisterwahl war nur möglich, weil die demokratische Opposition sich mit der bis vor Kurzem als rechtsextrem geltenden Jobbik-Partei auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt hat.
Angesichts des gemischten Wahlsystems bedeutet das praktisch, dass in jedem Wahlkreis ein ähnlicher Deal gemacht werden muss, um überhaupt eine erneute Fidesz-Mehrheit im Parlament verhindern zu können.
Tatsächlich laufen jetzt, auf den letzten Drücker, Verhandlungen zwischen den demokratischen Parteien und Jobbik, damit eine Einigung auf gemeinsame Kandidaten in so vielen Wahlkreisen wie möglich erzielt wird. Gleichzeitig kamen in den vergangenen Wochen immer mehr Korruptionsskandale ans Licht, in die hochrangige Regierungsmitglieder, Fidesz-Funktionäre und Orbáns berüchtigter Schwiegersohn István Tiborcz verwickelt sind.
Herrschaft Sollte man also die Gunst der Stunde nutzen, um der rechtspopulistischen Herrschaft ein Ende zu setzen, bevor es vielleicht zu spät ist? Aktivist Ádám Schönberger ist der Meinung, dass dies im Moment der einzige Ausweg ist. »Die demokratischen Parteien müssen mit Jobbik verhandeln. Es wäre unverantwortlich, weitere vier Jahre unter Orbán in Kauf zu nehmen.«
Zwar wisse heute niemand, was im Falle einer Niederlage der Fidesz passieren könnte und wie stabil eine Koalition des immer noch zerstrittenen linksliberalen Lagers mit Jobbik sein würde. Vorstellbar wäre etwa ein sehr begrenztes Bündnis auf Zeit: die krassesten undemokratischen Gesetzesänderungen der vergangenen acht Jahre schnell rückgängig machen, die Unabhängigkeit der Kontrollinstanzen, vor allem der Justiz, wiederherstellen, ein faireres Wahlrecht wiedereinführen und Neuwahlen organisieren.
Freilich mag dieses Szenario angesichts der antisemitischen und antidemokratischen Prägung der Jobbik als hoch riskant erscheinen. Doch »mit Orbán ist das kein Risiko, sondern bereits Realität«, meint Schönberger.
amtszeit Ähnlich beurteilt die Situation die bekannte Philosophin und Schoa-Überlebende Ágnes Heller, die als eine der Ersten das Notfallbündnis empfahl. Eine neue Amtszeit für Orbán sei das bei Weitem größte Übel, argumentiert sie.
In der Tat drohte der Ministerpräsident in seiner Rede am 15. März, dem Nationalfeiertag, damit, nach der Wahl »politische, moralische und juristische Genugtuung« zu suchen. Opposition und Zivilgesellschaft interpretierten diese Worte als Ankündigung weiterer Schritte in Richtung Autoritarismus.
Für den Verband der jüdischen Gemeinden, Mazsihisz, und seinen Vorsitzenden András Heisler ist das Thema zu heikel und zu direkt politisch, um öffentlich dazu Stellung zu nehmen. Doch für viele vor allem junge Juden, die man etwa in den Budapester Cafés trifft, scheint die Zeit reif für Veränderungen.