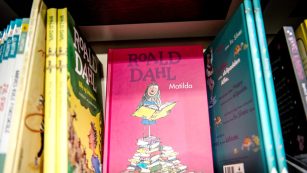Im alten Stadtkern von Subotica kommt Nostalgie auf: Zartgelbe Stuckfassaden, Erker und die frühere ungarische Kreditbank prägen die Stadt ganz im Norden Serbiens. Bäume säumen einen langen Platz, den ein mächtiger Kuppelbau überragt: die Synagoge im ungarischen Jugendstil. Der gusseiserne Zaun gibt den Blick auf frisch getünchte Außenwände und ein farbenfrohes Blumenfenster frei.
So makellos sah die Synagoge nicht immer aus. Erst wenige Monate ist es her, dass Hammer, Pinsel und Werkzeugkästen weggeräumt wurden. Über vier Jahrzehnte lang schienen die Baugerüste mit der Fassade verwachsen. Das ist nun Geschichte, mit Hilfe aus Budapest: Die ungarische Staatsspitze steuerte gut 2,2 Millionen Euro zur Sanierung bei.
SPENDEN Tomislav Halbror lebt schräg gegenüber der Synagoge. Der 72-Jährige, der früher Präsident der jüdischen Gemeinde von Subotica war, hat fast sein ganzes Leben hier verbracht. Die Synagoge ist Teil seiner Familiengeschichte: »Meine Großeltern gaben damals das meiste Geld von allen für den Bau«, sagt er lächelnd. Eine Namenstafel erinnert bis heute daran. »Jeder Jude aus Subotica und Umgebung hat damals etwas gespendet.«
Dass die Gaben nicht knapp waren, zeigte sich in üppiger Keramik, filigranen Glasfenstern und fünf Kuppeln: Als die Synagoge 1902 fertiggestellt wurde, galt sie als zweitgrößte in Europa, nach jener in Budapest. »Heute nimmt sie vielleicht den fünften Rang ein, da bei der Restaurierung Stuhlreihen weggefallen sind«, schätzt Halbror. 1100 Sitzplätze gibt es heute noch – und fast ebenso viele Gäste, Reporter und Kameraleute waren da, als der ungarische Premierminister Viktor Orbán und Serbiens Präsident Aleksandar Vucic die Synagoge Ende März wiedereröffneten.
Vermutlich ist sie heute die fünftgrößte Synagoge in Europa.
Dass die Restaurierung irgendwann abgeschlossen sei, habe er sich lange gewünscht: »Es wurde zwar immer etwas gemacht, aber nur das Notwendigste«, sagt Halbror. Das reichte jedoch irgendwann nicht mehr. In den 70er-Jahren war die Synagoge schließlich so marode, dass die Hauptkuppel einzustürzen drohte. Die kleine jüdische Gemeinde, die nach der Schoa noch in Subotica verblieben war, konnte das Geld für die Reparatur jedoch nicht aufbringen.
Also beschloss man, das Bethaus der Stadt zu übereignen. Diese sollte für die Restaurierung und später für Strom, Wasser und andere Kosten aufkommen. Im Gegenzug durfte sie das Gebäude als interkulturelles Zentrum nutzen, etwa für Konzerte.
Nicht alles verlief jedoch, wie es sollte: Die Arbeiten zogen sich in die Länge, die Fassade bröckelte weiterhin, der Wind pfiff durch einige Fenster, Heizung und Elektrokabel wurden nicht fachgemäß verlegt. Daher sei es mehrfach zu Kurzschlüssen gekommen, erinnert sich Jošua Štajnfeld, der seit einem Jahr Präsident der jüdischen Gemeinde in Subotica ist. Mitte der 80er-Jahre zog schließlich ein Avantgarde-Theater ein, das sich wenig um das Gebäude scherte: Pferde wurden gehalten und der mächtige Kronleuchter abmontiert.
JUGOSLAWIEN Als der Vielvölkerstaat Jugoslawien wenige Jahre später zerfiel und die Welt ein Embargo gegen das junge Serbien verhängte, rückte die Restaurierung in den Hintergrund – und bedrohte die Zukunft der Synagoge: Im Jahr 1996 setzte die Organisation World Monuments Watch das Bethaus auf die Liste der »100 am meisten bedrohten Kulturdenkmäler weltweit« – und steuerte über ihre Stiftung Geld für ein neues Dach bei.
Jüdische Organisationen, die EU, der serbische Staat – plötzlich gab jeder etwas. Richtig Fahrt nahm die Restaurierung aber erst 2014 auf, als die ungarische Regierung ein Programm zur Sanierung von Synagogen beschloss – darunter auch jener in Subotica.
Zum Gebet wurde die Synagoge schon lange nicht mehr genutzt. Zu groß war das Gebäude für die rund 250 Mitglieder, zu kalt die Winter. Stattdessen wurde die sogenannte Kleine Synagoge hergerichtet, im Erdgeschoss des Gemeindezentrums, nur wenige Meter entfernt. Am Schabbat treffen sich hier bis zu 30 Beter, an den Hohen Feiertagen seien es schon mal um die 100, schätzt Štajnfeld. Einen Rabbiner gibt es in Subotica nicht.
»Wir sind zwar klein, aber wir haben alles, was wir brauchen«, sagt Štajnfeld: eine koschere Küche, ein Büro, das jeden Tag besetzt sei, sieben von ehemals zehn Torarollen und Gruppenräume. Diese nutzen die Mitglieder, um Jiddisch zu lernen, Filme anzuschauen oder um eine Partie Schach zu spielen. Gerne lädt die Schachgruppe andere Spieler ein, etwa aus dem kroatischen Osijek – und schon wird ein internationales Turnier daraus. Auch der Frauenkreis bewirtet gerne Frauengruppen aus den übrigen ex-jugoslawischen Republiken: Bei Kaffee und Kuchen wird nett geplauscht.
Überhaupt ist der Austausch mit anderen jüdischen Gemeinden in der Region intensiv. Dass dies naheliegt, zeigt ein Blick auf die Landkarte: Die Landstraße nach Osten führt von der 140.000-Einwohner-Stadt Subotica direkt nach Rumänien, nach Westen ist Kroatien nicht weit, und bis zur ungarischen Grenze braucht man mit dem Auto nur eine gute Viertelstunde.
Doch so weit muss man gar nicht fahren: In Subotica gibt es ein ungarisches Generalkonsulat, das sich um die 300.000 Ungarn in der Region kümmert, und in den Schulen wird zweisprachig unterrichtet. »Jeder hier spricht Ungarisch und Serbisch«, sagt Štajnfeld.
Die Vielsprachigkeit in der Stadt kommt allen zugute: Schon jetzt, wenige Monate nach der Wiedereröffnung der Synagoge, verzeichne man deutlich mehr Touristen, so die Auskunft des örtlichen Fremdenverkehrsamtes. Gemeindepräsident Štajnfeld legt Wert darauf, dass die Synagoge für alle geöffnet ist. Er sagt: »Es ist mir wichtig, dass andere sehen, wo meine Großeltern früher gebetet haben.«