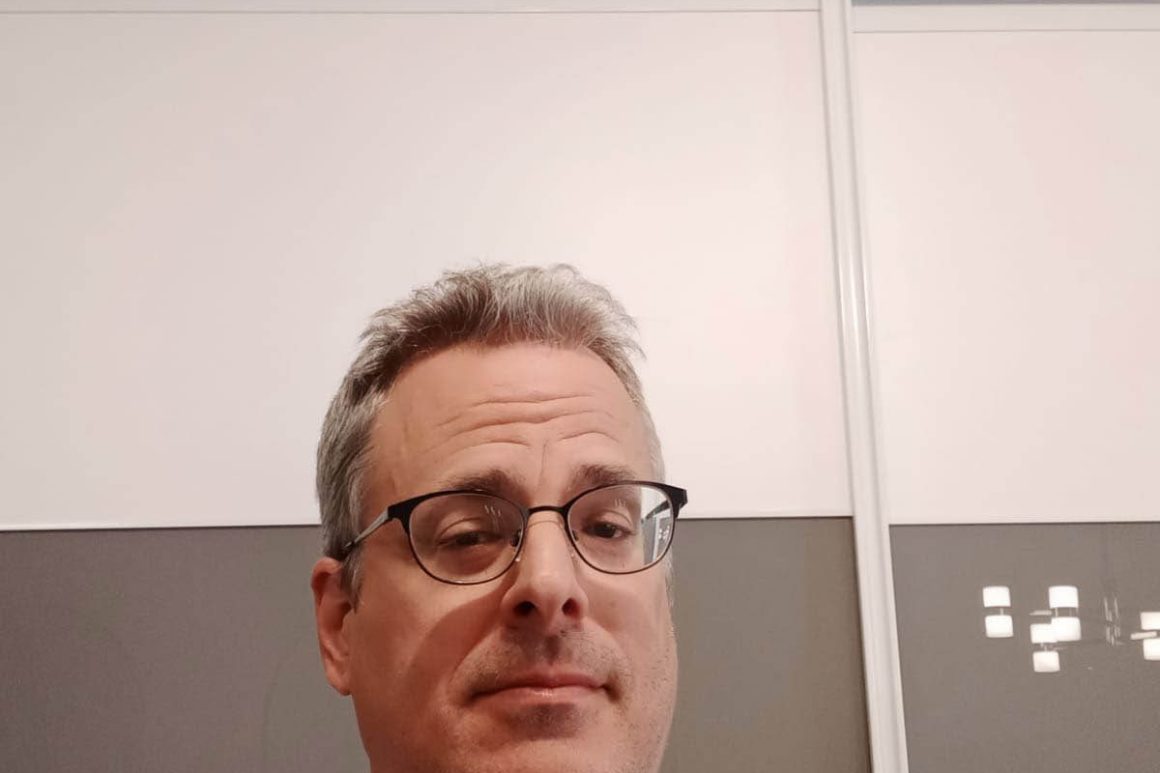Er ist »lone soldier«. Einsam ist er jedoch nicht – zumindest nicht immer. Stabsunteroffizier A., ursprünglich aus New York, lebt seit vier Jahren in Israel und dient in der Armee. »Ich bin ganz allein hier, habe keine Familie. Aber Israel hat mich mit offenen Armen aufgenommen.« Doch auch für A. hat die Corona-Krise Änderungen gebracht.
»Früher sind wir lone soldiers jede Woche von Familien im ganzen Land zum Schabbatessen eingeladen worden. Nun geht es ja nicht mehr, und das fehlt mir. Denn wenn wir nach Hause kommen, ist da niemand, der auf uns wartet.« Um mit seiner Familie in den USA in Kontakt zu bleiben, werden regelmäßig Videos hin- und hergeschickt.
Währenddessen ist die Armee noch mehr zur Familie geworden. »Wir sind die ganze Woche zusammen in der Basis isoliert, da ist man mehr als nur ein Team.« Vor einer Weile war A. in Quarantäne in seiner Wohngemeinschaft in Tel Aviv. »Da könnte man wirklich einsam werden.« Doch die Hotline für lone soldiers sei ihm zu Hilfe gekommen, habe täglich angerufen und gefragt, ob er etwas brauche und wie es ihm geht. »Das war ein sehr schönes Gefühl.«
SCHMERZ Das Herz von Monika Hadari ist gebrochen. Die Frau aus dem Kibbuz Gvat im Norden des Landes hat vor einigen Monaten ihren Mann verloren, mit dem sie seit der zwölften Klasse zusammen war. »Corona ist ein großer Schmerz für die Welt«, sagt sie, »doch meine Katastrophe ist der Tod von Dani.«
Ihre tägliche Routine hat sich durch Corona kaum geändert, denn innerhalb ihrer Kooperative kann sie sich relativ frei bewegen. »Allerdings hat sich die Atmosphäre in der Welt verschlechtert, und das spürt man.« Was der 87-jährigen Keramikkünstlerin am meisten zu schaffen macht, ist, ihre drei Kinder, sieben Enkelkinder und das neue Urenkelkind nicht sehen zu können, das erst vor wenigen Monaten geboren ist. »Meine Familienmitglieder sind alle unterschiedlich und ganz wunderbar. Sie nicht treffen zu können, ist sehr traurig für mich und sie.«
Obwohl sie Mobiltelefone eigentlich gar nicht mag, schätzt sie es jetzt, auf diese Weise mit ihnen zu kommunizieren. »Manchmal habe ich sogar das Gefühl, wir reden zu viel«, sagt sie und lacht. »Aber es tut mir gut.« Unterstützung gibt es auch aus dem Kibbuz. »Es ist immer jemand da, wenn ich ein Problem habe. Erst heute Mittag kam eine Nachbarin ohne Ankündigung und brachte mir eine große Schale Reis mit frischem Gemüse. Es ist wunderbar, wie sehr man sich gegenseitig hilft.«
KRAFTAKT Scott Hirsch lebt im jüdischen Viertel der Altstadt von Jerusalem. Dort, wo die Infektionen mit am höchsten sind. Der Erfinder und Berater von Start-ups meint, es könnte schlimmer sein. Zu Beginn des Corona-Ausbruchs war der orthodoxe Familienvater von acht Kindern stolz auf Israels »proaktive Reaktion«, doch heute ist er es nicht mehr, sondern sieht den zweiten Lockdown als verzweifelte Maßnahme, die der Wirtschaft unglaublich zusetzt.
Im Kibbuz kann sich Monika Hadari relativ frei bewegen.
Der 52-Jährige sagt, dass sich vor allem sein tägliches Bewusstsein geändert hat. »Dinge, die wir als selbstverständlich angesehen haben, existieren nicht mehr. Wenn eines von meinen Kindern niest, überlege ich mir, ob ich in die Synagoge gehen kann.« Negativen Gedanken will sich Hirsch aber nicht hingeben. »Die Hohen Feiertage stehen dafür, einen frischen Start zu wagen. So will ich die Pandemie sehen – dass sie der Welt neue Möglichkeiten eröffnet.«
Auch persönlich hat er vor, durch die Krise zu wachsen. »Oft stecken die Menschen in alten Strukturen fest. Aber heute ist es nicht mehr möglich, so zu tun, als bliebe alles gleich. Alles Planen ist vergebens. Wir müssen uns auf Neues einlassen.« Der Tod seiner Schwägerin inmitten der Krise im April habe ihm zudem gezeigt, wie sehr die Unwägbarkeiten genutzt werden können, um als Familie zusammenzuwachsen. »Wir haben es geschafft, den Leichnam von Los Angeles über New York bis nach Israel zu bringen. Es war ein gemeinschaftlicher Kraftakt.«
ENTLASSUNG Amit Rose fühlt vor allem mit den Menschen, die durch die Krise ihren Job verloren haben. Sie arbeitet für eine Modefirma und musste vor einigen Tagen als Teamleiterin zwei junge Frauen entlassen, weil keine Arbeit mehr da war. »Das war eine schreckliche Situation. Es tut mir so leid.« Sie weiß, es könnte es auch sie jederzeit treffen.
Dennoch sieht die 25-Jährige aus Rechowot für sich persönlich im Lockdown Positives: »Ich bin durch Corona wieder zu meinen Eltern gezogen, und wir sind uns so nah wie nie zuvor. Das ist fantastisch. Unter normalen Umständen wäre das nie passiert.« Außerdem findet sie die Zeit zu Hause wertvoll, um sich mit »wirklich Wichtigem« zu beschäftigen. Geld spare sie obendrein, weil jegliches Ausgehen weggefallen ist.
Derzeit arbeitet sie im Homeoffice. Schwierig daran findet sie, dass es die Trennung zwischen Haus und Büro nicht gibt. »Ich fange meist später mit der Arbeit an und sitze länger dran, weil ich mich ablenken lasse. Da gibt es noch viel für mich zu tun.«
ROUTINE Tali Levy lebt mit ihrem Ehemann Itzik und drei Kindern in einer kleinen Wohnung in Tel Aviv. Derzeit sind sie in Quarantäne und arbeiten von zu Hause. »Die Distanz innerhalb einer Wohnung zu wahren, ist extrem schwer. Wir dürfen nicht mit unseren Kindern zusammen kochen oder essen und müssen jeden Kontakt vermeiden.«
In einigen Tagen ist die Quarantäne vorbei, dann gehen die Levys zur Routine über – im Lockdown. »Die Tage sind eigentlich immer dieselben, wir haben unsere Routine gefunden«, sagt Tali Levy am Telefon. Zwei ihrer Kinder sind in der Armee und nur am Wochenende zu Hause, der 13-jährige Sohn hat digitalen Schulunterricht, was gut funktioniere.
Was sich für die Familie geändert hat, ist vor allem die Sportroutine. »Das machen mein Mann und ich jeden Tag im Wohnzimmer, um gesund zu bleiben. Sehr zur Belustigung unserer Kinder.« Schwer sei die Trennung von ihrer erweiterten Familie. »Es ist deprimierend, dass wir unsere Eltern nicht mehr so oft sehen können.« Ihren Mann macht vor allem seine Arbeit derzeit traurig. Er ist Altenpfleger und sieht, wie sehr die Einsamkeit vieler Menschen durch die Pandemie verstärkt wird. Beide meinen, dass es mit diesen extremen Maßnahmen so nicht mehr lange weitergehen kann und man stattdessen »lernen muss, wie man mit dem Virus lebt«.