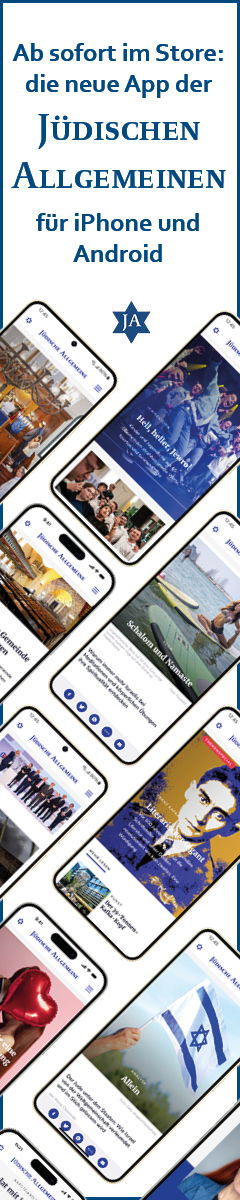Der Festsaal im Alten Rathaus mit der hohen Decke, den hölzernen Vertäfelungen und den imposanten Leuchten war für die Gedenkfeier zum Jahrestag der »Reichskristallnacht« am Sonntag vergangener Woche ein würdiger, aber auch ein beklemmender Ort.
Vor genau 76 Jahren, am 9. November 1938, gab hier Joseph Goebbels mit einer hasserfüllten Hetzrede den Startschuss für einen bis dahin beispiellosen Exzess antisemitischen Terrors. Unter den vielen Gästen der Gedenkfeier, die die Erinnerung an die Pogromnacht aufrechterhalten wollten, befanden sich auch einige in München lebende Juden, die die Schreckensereignisse erlebt und überlebt haben. Auch IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch gehörte dazu.
fragen Die Ergriffenheit der Präsidentin, ihre rückblickenden Gedanken an das Unfassbare in dieser Novembernacht des Jahres 1938, waren förmlich spürbar, als sie ans Rednerpult trat. Dennoch sei diesmal etwas anders als bei den Gedenkveranstaltungen der vergangenen Jahre, merkte die Präsidentin hinsichtlich der Explosion des Judenhasses während des Gaza-Kriegs dieses Jahr an. »Rückblickend auf diesen Sommer des antisemitischen Hasses stelle ich 76 Jahre nach der sogenannten Reichskristallnacht dieselbe Frage, die ich mir als Sechsjährige gestellt habe: Warum lassen Menschen so etwas zu?«
Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter ging in seiner Rede auf dieses Aufflammen des Antisemitismus ein: »Wie ungehemmt und aggressiv rechtsextremistischer, rassistischer, menschenverachtender Hass geschürt, gegrölt und in die Gesellschaft getragen wird, das hat vor Kurzem erst wieder die Welle der antisemitischen Anfeindungen und Übergriffe gezeigt, die jüdischen Bürgern unter dem Deckmantel der Kritik am israelischen Vorgehen gegen die Hamas in Gaza entgegenschlug.«
Dass sich dann die Kultusgemeinde genötigt sah, selbst eine Kundgebung unter dem Motto »Wehret den Anfängen« zu organisieren, sei »alarmierend«. Der Oberbürgermeister, der auch auf die besondere Verantwortung Münchens als ehemalige »Hauptstadt der Bewegung« hinwies, glaubt trotzdem, ein »ermutigendes Zeichen« entdeckt zu haben: die breite und positive Resonanz, die die Kundgebung am 29. Juli auf dem Platz der Opfer des Nationalsozialismus gefunden habe.
Hass Auch Reiters Vorgänger im Amt des Oberbürgermeisters, Christian Ude, zeigte sich bestürzt über das Aufflammen antisemitischen Hasses und den offenkundigen Anstieg des Rechtsextremismus. Mit Blick auf die beispiellose Mordserie des »Nationalsozialistischen Untergrunds« resümierte er: »Es sind Dinge geschehen, die nicht für möglich gehalten wurden.«
Ein Beleg dafür, dass das Wachhalten der Erinnerung an die Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung durch die Nazis in München einen sehr hohen Stellenwert genießt, war die Anwesenheit aller ehemaligen Stadtoberhäupter. Neben dem amtierenden Oberbürgermeister Dieter Reiter waren auch seine Vorgänger Christian Ude, Hans-Jochen Vogel und Georg Kronawitter im Alten Rathaus erschienen.
Die Veranstaltung, die vom Ensemble des Polizeiorchesters Bayern musikalisch begleitet wurde, schloss sich an eine öffentliche Namenslesung am Gedenkstein der ehemaligen Hauptsynagoge an. Münchner Bürger, Schüler sowie Angehörige der Bundeswehr und der Polizei hatten am Nachmittag die Namen von rund 500 jüdischen Bürgern verlesen, die im Ersten Weltkrieg als Soldaten ihren »Dienst am Vaterland« geleistet hatten. Auch sie wurden in der »Reichskristallnacht« und den darauf folgenden Jahren deportiert und ermordet.
verstörend Das Schicksal der Juden, die vor 100 Jahren im Ersten Weltkrieg für Deutschland in den Krieg zogen, beleuchtete bei der Gedenkfeier General a.D. Wolfgang Schneiderhan. Sein Vortrag mit dem Titel »Dazu hält man für sein Land den Schädel hin« führe zurück zu einer »verstörenden Geschichte«, wie er ankündigte.
Der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr wies vor allem aber auch auf die Konsequenzen hin, die heute gezogen werden müssten: »Das Drama der Entrechtung jüdischer Staatsbürger in Uniform in der Gesellschaft und den Streitkräften muss Teil unseres gemeinsamen Gedächtnisses werden.« Die Mahnung und Warnung zur freiheitlichen Grundordnung sei eine Lehre der Geschichte, die man nicht ignorieren könne, so Schneiderhan.
»Hat die Welt, haben wir Deutschen aus den Fehlern gelernt?« Es war ein leicht zweifelnder Unterton zu spüren, als Charlotte Knobloch diese Frage den vielen prominenten Gästen der Gedenkfeier stellte und an das Entstehen des Nationalsozialismus erinnerte: »Die Wirklichkeit war damals offenkundig, aber viele Deutsche sowie die Mächtigen im Ausland wollten sie nicht sehen. Sie blieb ihnen verborgen in einer Wolke von Illusionen.«
Stimmung Wiederholt sich das? Die judenfeindlichen Demonstrationen vom Sommer beunruhigen die IKG-Präsidentin zutiefst: »Die Wucht, mit der uns in diesem Jahr der blanke Hass getroffen hat, hinterließ tiefe Wunden. Es waren nicht nur Islamisten, die mit antijüdischer Hetze agierten. Die aufgeheizte Stimmung fand auch viele Mitstreiter von Links und Rechts sowie in der breiten bürgerlichen Mitte, wo Antisemitismus nach wie vor auf fruchtbaren Boden fällt.«
Charlotte Knobloch erinnerte sich bei der Gedenkfeier an ihr persönliches Erlebnis in der schicksalhaften Nacht vor 76 Jahren, als ihr Vater sie fest an die Hand nahm. An die Gäste gewandt, sagte sie: »Wenn ich heute in Gedanken die Hand meines Vaters drücke, denke ich an jene Nacht im Jahr 1938, aber auch an die Kundgebung am 29. Juli. Ich blicke in Ihre Gesichter und bitte Sie: Lassen Sie nicht zu, dass wir Juden fürchten müssen, erneut einer Illusion erlegen zu sein.«
Wortlaut des Vortrages von General a.D. Wolfgang Schneiderhan
»Dazu hält man für sein Land den Schädel hin. Deutsche Soldaten jüdischen Glaubens im Ersten Weltkrieg – die beklemmende Geschichte zurückgewiesener Patrioten«:
»Dazu hält man für sein Land den Schädel hin«, so entfuhr es spontan dem jüdischen Feldwebel Julius Marx, als sein Kompanieführer ihn am 2. November 1916 in sein Büro befahl – im Keller eines Hauses in einem französischen Dorf, das gerade unter Artilleriebeschuss lag. Er las ihm den Erlass des preußischen Kriegsministeriums vom 11. Oktober vor und bat ihn um seine persönlichen Daten. Das war die »Nachweisung der beim Heer befindlichen Juden«, kurz »Judenzählung« genannt. Eine furchtbare Ohrfeige nannte das Georg Meyer, Soldat in einem bayrischen Feldartillerie-Regiment, in seinem Tagebuch. Was er »Ohrfeige« nannte, war wohl eine der folgenschwersten innenpolitischen Entscheidungen jener Zeit.
Dass die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern im Einvernehmen mit vielen städtischen und gesellschaftlichen Institutionen am Gedenktag des 9. November 1938 das Schicksal deutscher Soldaten jüdischen Glaubens im Ersten Weltkrieg in den Mittelpunkt stellt, ist nach 100 Jahren auch eine Verneigung vor den so geschmähten deutschen Patrioten. Dass Sie dazu einen ehemaligen Soldaten der Bundeswehr als Redner eingeladen hat, ehrt mich außerordentlich. Ich werde Ihnen meine Gedanken als Soldat anbieten ohne wissenschaftlichen Anspruch.
Ich will Ihnen erzählen, warum mich diese Soldatenschicksale immer umgetrieben haben und bis heute bewegen. Mein Beitrag kann aber nur ein weiterer Wegweiser sein auf dem Lehrpfad der Geschichte zum Thema Menschenwürde in der Gesellschaft und auch und vor allem in den Streitkräften und damit zu dem immerwährenden, sehr deutschen Thema, nämlich dem Verhältnis von Geist, Macht und Moral. Schlagen wir also heute das Buch der Geschichte »Deutsche jüdische Soldaten« auf und stellen wir uns einer langen beklemmenden Erzählung.
Es ist eine Erzählung von der Hoffnung auf Emanzipation und Integration auf der einen Seite und von Enttäuschung, Entehrung und Verrat auf der anderen Seite. Die hohe Beteiligung jüdischer Freiwilliger an den Feldzügen der Befreiungskriege 1813 und die patriotische Aufbruchstimmung, auch das Wehrgesetz von 1894, nährten die Hoffnung vieler, dass der Durchbruch zu umfassender Emanzipation der jüdischen Mitbürger gelungen sei. Der Zustand rechtlicher, politischer und bürgerlicher Gleichheit schien in greifbarer Nähe vor allem im Einklang von politisch gesellschaftlicher Position und Militärpflichtigkeit. Wehrpflicht zu leisten, war damals höchster Ausdruck staatsbürgerlicher Anerkennung. Der Genuss der vollen Staatsbürgerrechte bedingte die Erfüllung der Wehrpflicht. Aber schon 1818 am Beginn der Restaurationsära verhallte der patriotische Aufbruch ohne sonderliches Echo im christlichen Preußenstaat – fast alle emanzipatorischen Errungenschaften wurden zurückgedreht bis hin zur Invalidenversorgung und dem Versagen von Beförderungen. Was weder Freiheitskriege noch Reformen bewirken konnten, es gelang dann doch noch in der 48er-Revolution mit der Verfassung der Paulskirehe – die rechtliche Gleichstellung der Juden wurde zum Verfassungsinhalt. »Die Ausübung staatsbürgerlicher Rechte ist fortan von dem religiösen Glaubensbekenntnis unabhängig«, so stand es da geschrieben. Aus Sicht der jüdischen Minderheit verwirklichte die Revolution den »Traum von der völligen Emanzipation«. Vor diesem Hintergrund haben jüdische Soldaten aus allen Teilen Deutschlands an den Kämpfen 1848/49 teilgenommen. Aber nach dem Sieg über die Revolution von 1848 und der Niederlage der Paulskirchenversammlung sind die verheißungsvollen Ansätze vor allem in der Armee wieder zunichte gemacht worden. Die Prozeduren des Militärs bleiben die alten: der jüdische Vorgesetzte eine Ausnahme, keine Juden im Offizierkorps. Das alles geschah auch noch in der Zeit nach dem Erlass des Gesetzes des Norddeutschen Bundes von 1869 über die Gleichberechtigung der Konfessionen, dem 1862 in Baden und 1964 in Württemberg die Aufhebung der Beschränkungen der bürgerlichen Rechte der Juden vorausgegangen war.
Wieder war es dann ein Krieg, diesmal der Deutsch-Französische 1870/71, in dem die Juden eine Chance sahen, ihren Patriotismus gegen den wachsenden Antisemitismus in die Waagschale zu werfen. Jüdische Soldaten bewährten sich wie ihre nicht jüdischen Kameraden. Jüdische Mitbürger dienten als Sanitätsoffiziere, andere wurden zu Reserveoffizieren ernannt, es gab höchste Dekorationen wie das Eiserne Kreuz. Aber der Durchbruch gelang nicht. Schon in den 80er-Jahren setzte die massive Gegenbewegung ein, wohl auch im Gleichklang mit dem wachsenden Antisemitismus in Gesellschaft und Armee, wohl auch – aber nicht nur – genährt durch die Hetzpropaganda in der einsetzenden »großen Depression«.
Die Bedeutung des Reserveoffiziers in der Wilhelminischen Gesellschaft – als Schlüssel zum gesellschaftlichen Aufstieg, also zur Gesellschaftsfähigkeit und als Schlüssel für den Zugang zu anderen Staatsämtern begründet und erklärt die Versuche der Juden, dieses Privileg zu bekommen. An die aktive Offizierlaufbahn war nie zu denken und der Versuch auch längst aufgegeben.
Walther Rathenau leistete den Einjährigen-Freiwilligen Dienst wie viele andere in der Hoffnung ab, den Offiziersrang zu erreichen – keine Chancen. Die Armee stoppte ihn als Vizewachtmeister bei den Kürassieren. Er beschrieb 1911 diese Diskriminierung sehr eindrücklich. Für jeden nicht konvertierten Juden komme »der schmerzliche Augenblick, an den er sich zeitlebens erinnert: wenn ihm zum ersten Mal voll bewusst wird, dass er als Bürger zweiter Klasse in die Welt getreten ist und keine Tüchtigkeit und kein Verdienst ihn aus dieser Lage befreien kann«.
Und ausgerechnet dieser Walther Rathenau trug dann mit der Schaffung des Rohstoffamtes im Kriegsministerium wesentlich dazu bei, dass die deutsche Kriegswirtschaft nicht schon nach wenigen Monaten zusammenbrach. Aber Reserveoffizier durfte er nicht werden. Er dankte 1915 in einer Rede gleich drei preußischen Kriegsministern für ihr Vertrauen in ihn. Wenige Jahre später war von diesem Vertrauen nichts mehr übrig, und er wurde Opfer nationalsozialistischer Mörder. Dass die deutschen Juden in ihrem Kampf um Gleichberechtigung sich stärker auf den Linksliberalismus als auf den Nationalliberalismus zu verlassen begannen, wurde auch in der Armee zur Kenntnis genommen und zum emotionalen Aufladen des Antisemitismus entschlossen genutzt. Kriegsminister Josias von Heerirrgen musste dies im Reichstag einräumen. Wilhelm II. gab im März 1890 eine Order über die Offizierergänzung heraus, die diesen Geist erkennen ließ. Danach kamen als Reservoir für das Offizierkorps nur solche »bürgerlichen Häuser« in Betracht, in denen neben Liebe zum König und Vaterland »christliche Gesittung gepflegt und anerzogen würde«. Wie weit die Diskriminierung ging, zeigt eine 1909 erstellte private, in der Frankfurter Zeitung publizierte Statistik, wonach seit 1880 mindestens 25 000 Einjährig-Freiwillige jüdischen Glaubens dienten, von denen nicht einer zum Reserveoffizier und nur wenige zu Unteroffizieren befördert wurden. Anders bei den 1200 bis 1500 Einjährig-Freiwilligen, die sich taufen ließen. Von denen erhielten 300 das Offizierspatent.
Der Geist in der Armee entsprach immer mehr dem sich aufladenden Antisemitismus in der Gesellschaft. Man kann sogar sagen, dass das Heer an der Spitze stand. Man wusste vom stillschweigenden Einverständnis des Kaiserhauses. Die Aristokratie, in der Mehrzahl eher nicht judenfreundlich, sah das Militär als seine Domäne an. Ihre Söhne konnten dort auch ohne höhere Schulbildung Offizier werden. Absicherung der alten Privilegien gegen wachsende Partizipation – auch das gehört zum Bild.
Und dennoch: All dies hat bei Kriegsausbruch 1914 eine große Welle jüdischen Patriotismus nicht verhindert. Wieder – wie 1813/14 – sah man die Chance, durch militärische Pflichterfüllung die eigene Lage in Staat und Gesellschaft nachhaltig zu verbessern. Es war die erneute Gelegenheit, Loyalität und Ergebenheit für die deutsche Sache unter Beweis zu stellen. »Liebt nächst Gott das Vaterland« so lautete der Aufruf zum patriotischen Dienst. Eine Stelle des Testamentes von Leutnant Josef Zürndorfer gibt uns einen Einblick in das Innenleben dieser tapferen Mitbürger: »Ich bin als Deutscher ins Feld gezogen, um mein bedrängtes Vaterland zu schützen. Aber auch als Jude, um die volle Gleichberechtigung meiner Glaubensbrüder zu erstreiten.« Am 19. September 1915 stürzte er bei einem Flugunfall bei Berlin ab und fand den Tod als Leutnant der Reserve. Ich erinnere an den Aufruf jüdischer Verbände vom August 1914: »Deutsche Juden! In dieser Stunde gilt es für uns aufs Neue zu zeigen, dass wir stammesstolzen Juden zu den besten Söhnen des Vaterlandes gehören. Der Adel unserer viel tausendjährigen Geschichte verpflichtet. Wir erwarten, dass unsere Jugend freudigen Herzens zu den Fahnen eilt. Deutsche Juden! Wir rufen Euch auf, im Sinne des alten jüdischen Pflichtgebots mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Vermögen Euch dem Dienste des Vaterlandes hinzugeben«.
Über zehntausend deutsche Juden meldeten sich freiwillig. So auch der Reichstagsabgeordnete der SPD, Ludwig Frank, ein doppelter Außenseiter also. Ich zitiere ihn aus einem seiner letzten Briefe: »Ich stehe in der Front wie jeder andere, ich werde von allen (Mannschaften wie Offizieren mit größter Rücksicht (protzig ausgedrückt: Ehrerbietung!) behandelt. Aber ich weiß nicht, ob auch die französischen Kugeln meine parlamentarische Immunität achten. Ich habe den sehnlichsten Wunsch, den Krieg zu überleben und dann am Innenbau des Reiches mitzuschaffen. Aber jetzt ist für mich der einzig mögliche Platz in der Linie in Reih und Glied, und ich gehe wie alle anderen freudig und siegessicher.« Wenige Tage später, am 3. September 1914 fiel der Vierzigjährige.
Wie Frank glaubten auch viele andere Kriegsfreiwillige, durch besonderen Einsatz ihre nationale Zuverlässigkeit beweisen und damit endlich die vollkommene Gleichstellung der Juden durchsetzen zu können. Und tatsächlich schien es in den ersten Kriegswochen, als erfüllte sich diese Hoffnung.
Wir würden der Tragik des jüdisch-deutschen Patriotismus nicht gerecht, wenn wir nur von der Front erzählen würden. Ich erwähnte bereits Walther Rathenau und seinen Beitrag zur Durchhaltefähigkeit der Kriegswirtschaft: Eine aus heutiger Sicht besonders tragische Figur war der jüdisch-deutsche Chemiker Fritz Haber. Er entwickelte das Verfahren zur synthetischen Herstellung von Ammoniak. Damit war Deutschland in der Lage, Sprengstoff unabhängig von chilenischem Salpeter zu produzieren und konnte aus diesem Grund den Krieg so lange durchhalten.
96 000 jüdische Kriegsteilnehmer, also rund 17 Prozent der jüdischen Bevölkerung (von 550 000), rund 12 Prozent Kriegsfreiwillige, mehr als 77 Prozent an der Front. Gefallen, gestorben, vermisst 12 Prozent also 10 110. Es ist eine Tatsache, dass der Anteil der Juden an Kriegsteilnehmern und Opfern ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entsprach. Fast 30 000 wurden dekoriert, fast 1200 gehörten zu den Sanitätsoffizieren und den Militärbeamten im Offiziersrang. Eine Bilanz aller Ehren wert. Und dennoch und wieder: keine Chance zur Integration. Wir nutzen heute die Gelegenheit, ihnen öffentlich Respekt und Ehre zu erweisen. Das liegt mir am Herzen. Das haben sie längst verdient.
Das Pathos, die demonstrativ ausgedrückte Liebe zum Vaterland, die Appelle an Pflichterfüllung, Opferbereitschaft, die Überzeugung, als Soldat das Vaterland verteidigen zu müssen, das alles ist uns heute fremd geworden, und trotzdem zeigen sie, welche große Hoffnungen auf deutsch – jüdischer Seite mit Pflichterfüllung und Engagement verbunden waren. »Wirkliche Gleichberechtigung« zu erreichen, das war der Wunsch. Aber es gelang bei allen Anstrengungen nicht, dem Antisemitismus, der bereits vor 1914 tief in allen Poren der wilhelminischen Gesellschaft eingedrungen war, das Wasser abzugraben.
Auch der vom Kaiser Wilhelm II. proklamierte »Burgfriede« (»Ich kenne keine Parteien und auch keine Konfessionen mehr«) währte nicht lange, auch nicht für die jüdischen Soldaten. Im Offizierkorps breitete sich der Antisemitismus aus, antisemitische Agitation griff um sich, jüdische Soldaten wurden beleidigt und als Drückeberger beschimpft.
Und dann kam die tief verletzende, unsägliche Entscheidung vom 11. Oktober 1916 des Kriegsministers: Er ordnete für den 1. November eine Nachweisung der beim Heer stehenden Wehrpflichtigen sowie der vom Waffendienst zurückgestellten oder dienstuntaugliche Juden an. Dem Druck der extremen Antisemiten und der antijüdischen Tendenzen in Stabsstellen wurde wieder nachgegeben. Angeblich wollte man mit dieser Erhebung den wachsenden Klagen über die jüdische »Drückebergerei« entgegentreten. Tatsächlich aber war sie nichts anderes als die staatliche Anerkennung und Legitimation des Antisemitismus. Die Zählung wurde 1917 dann zwar eingestellt, zu einer Anerkennung der jüdischen Kriegsleistungen konnte man sich aber nicht durchringen.
Es gab aber Druck auf das Kriegsministerium. Sozialdemokratie und Freiheitspartei kritisierten den Erlass im Reichstag als Bruch des »Burgfriedens« und als militärisch verfehlt. Schließlich sah sich der Kriegsminister veranlasst, gegenüber dem Verband der Deutschen Juden zu erklären, dass das Verhalten der jüdischen Soldaten und Mitbürger während des Krieges keine Veranlassung zu der Anordnung meiner Vorgänger gegeben hat und damit nicht in Beziehung gebracht werden kann. Die Wirkung im Verband war so außerordentlich, dass ein Huldigungstelegramm an Wilhelm I. beschlossen wurde, in dem es hieß, ohne Deutschlands Ruhm und Größe könne ein echter deutscher Jude überhaupt nicht existieren und atmen. Diese Adresse kennzeichnet das von Hoffnung und Enttäuschung, von Anziehung und Abstoßung irritierte Verhältnis der deutschen Juden zu Staat und der Gesellschaft. Die Armee kümmerte sich nicht um die wohlgemeinten Ausführungen des Kriegsministers. Sie hatte sich längst der politischen Kontrolle entzogen; Staat im Staat nannte man das später.
Die Armee selbst hat den »Burgfrieden« aufgekündigt: Selbst mitten im Krieg ließ sich nicht einmal durch Waffenbrüderschaft ein kameradschaftlich selbstverständliches Nebeneinander gewinnen. Gegen zwei Feinde mussten sich die jüdischen Soldaten behaupten: Gegen den äußeren und gegen die inneren in den Reihen der Kameraden. Und es ist diese bittere Erkenntnis, die mich als ehemaliger Soldat beschämt und traurig macht: Das Militär hat sich vom anfänglichen Wegbereiter der Emanzipation vor dem Kaiserreich zu einem Hort der Diskriminierung im Kaiserreich und danach entwickelt. Mit der Demobilisierung und die Überführung in die Reichswehr endete der Dienst jüdischer Soldaten. Alle Hoffnungen. wenigstens als Frontsoldat weitere Ausgrenzung bis dann zur Verfolgung abwehren zu können, blieben unerfüllt. Die Ausgrenzung blieb nicht nur, sie verschärfte sich. Die Leistungen jüdischer Soldaten wurden geleugnet, ja man gab ihnen sogar die Schuld an der militärischen Niederlage – die Legende vom »Dolchstoß« war willkommen in der Weimarer Republik. Nach der Friedensresolution der Mehrheitsparteien vom 19. Juli 1917 setzten die Polemik und die Strategie der Verdächtigungen mit voller Wucht ein. Schuldzuweisungen an Demokraten, Liberale, Sozialisten, Kommunisten und Juden definierten, wer Schuld am Untergang hat: Der Vorsitzende des alldeutschen Verbandes, General Freiherr von Gehsattel sagte es so: »Die entarteten Undeutschen unter alljüdischer Leitung«.
Damit dürfen wir das Buch der Geschichte aber noch nicht zumachen. Der ungeheuerliche Prozess der Abstoßung ging in dem unsäglichen Teufelskreis nur so weiter: Die deutschen Juden setzten am Ende des Krieges ihre Hoffnungen auf ein neues, demokratisches Deutschland und engagierten sich politisch im Umbruch und steigerten so den Hass der alten Gegner noch weiter. Dieser Hass erfasste die sich auflösende Armee, ging über die Freikorps in die Reichswehr hinein. Die Reichswehrführung unterband die Entwicklung leider nicht. Mit lauen Formulierungen wurde die »Stellung zur Judenfrage« zur Privatsache jedes Einzelnen gemacht. Auch Noske ging nicht weiter. Damit war der offenen Mordhetze gegen Juden Tür und Tor geöffnet, gebündelt im »Deutsch-völkischen Schutz - und Trutzbund«, aus dessen Umkreis dann auch die Mörder Rathenaus kamen, und die ehemaligen Soldaten, die Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordeten. Die hohe Beteiligung jüdischer Soldaten in den revolutionären Gruppen hat das Feuer unter dem Zerrbild »jüdische Weltverschwörung« noch weiter angefacht. Es ist schmerzlich, wie alte soldatische Tugenden vor der radikalen antisemitischen Wühlarbeit in vielen Truppenteilen in die Knie ging. Bis ganz hinauf in die oberste Heeresleitung. Die junge Republik, auf die so viel Hoffnung gesetzt wurde, hat in ihren Streitkräften genauso wenig, wenn nicht noch weniger gesicherten Raum gegeben wie die alte Armee, die immerhin noch jüdische Wehrpflichtige zugelassen hat – weil sie sie brauchte.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurde die radikale Aussperrung der Juden aus dem öffentlichen Leben, der Kultur, der Wirtschaft mit hoher Beschleunigung durchgesetzt: Mit geringen Ausnahmen für die »Frontkämpfer« und Veteranen von 1864, 1866 und 1870/71 wurden die »Arierbestimmungen« schleichend im Militär umgesetzt: keine Einstellung »nichtarischer Bewerber, die Heiratsordnung – Bräute von Soldaten müssen »arischer Abstammung« sein – bis zum Ausschluss der »Nichtarier« aus den Kriegervereinen. Gegen all diese Entwicklungen gab es nur ganz wenige und sehr verhaltene Äußerungen des Protestes (von Manstein z.B.), aber sie waren schon Zeugnisse einer schon lange nicht mehr intakten politischen Moral und soldatischen Tugend.
Wir haben gesehen, wie Verfassungsrecht durch Einzelgesetzgebung und Verwaltungspraxis ausgehebelt werden kann und so Meilensteine auf dem Weg aus dem Rechtsstaat gesetzt werden können.
Wir wissen, wie dieser furchtbare Prozess, ein Abstoßungs- und Vernichtungsprozess mit der Katastrophe des Deutschen Reiches und seiner Wehrmacht geendet hat. Wir haben gesehen, wie kurz der Weg zum Zerfall der politischen Moral und zum Missbrauch bürgerlicher und soldatischer Tugenden ist, wenn die Fundamente abendländischer Kultur erst einmal zur Seite geschoben sind.
Ich weiß nicht, ob der Antisemitismus im Ersten Weltkrieg und auch die Judenzählung eine Episode oder eine Wasserscheide des Antisemitismus im 20. Jahrhundert waren. Darüber mögen sich die Historiker streiten.
Die bittere Verhöhnung des Patriotismus und der Opferbereitschaft der deutschen Juden im Ersten Weltkrieg ist für mich mehr als einfach »Risches«, also mehr als lästig, verletzend, entehrend. Diese Entwicklung kam nicht aus heiterem Himmel: Staatlich angeordnete Sonderbehandlung und Einschränkungen der bürgerlichen Rechte, anfangs schleichend durch Verwaltungspraxis, später dann durch Gesetze, kann auch die Saat gewesen sein, die später richtig aufging: 1933 mit dem Boykott jüdischer Geschäfte, 1935 mit den Nürnberger Gesetzen und dann 1938 mit dem Terror der so genannten Reichspogromnacht, deren Opfer wir heute auch gedenken, sicherlich ein Wendepunkt in der Geschichte der Judenverfolgung in Deutschland. Man hüte sich von dem Gegenrechnen mit anderen staatlich diskriminierten Bevölkerungsgruppen und vor allem: Wehret den Anfängen!
In dieser Geschichte liegt unsere Verpflichtung, das Andenken an die jüdischen Soldaten zu bewahren, die in den deutschen Armeen gedient haben und für ihr Vaterland kämpften und starben. Das Drama der Schmähung und Entrechtung jüdischer Staatsbürger in Uniform in Gesellschaft und in den Streitkräften selbst muss Teil unseres gemeinsamen Gedächtnisses werden. Deshalb wird am Volkstrauertag an vielen Orten - in Berlin, Frankfurt und München als Beispiele – der jüdischen Soldaten durch Soldaten der Bundeswehr gedacht. So kann die Geschichte deutscher jüdischer Soldaten mehr sein als die Geschichte eines am Ende grausamen Irrtums.
Ich habe heute viel über vorbildlichen und ehrenhaften Patriotismus geredet. Dabei habe ich aber auch immer über den Kampf um Emanzipation, Integration und Gleichberechtigung, also über den Kampf um Staatsbürgerrechte, die weit über die Jahre des Ersten Weltkrieges rückwärts und vorwärts hinausreicht. Unsere Fragen zielen dabei nicht allein auf die politischen und gesellschaftlichen Ursachen und Anlässe, sie zielen auch auf die mentalen und kulturellen Dispositionen. Damit sind sie aktuell.
Wenn wir also über die Geschichte der rechtlichen Gleichstellung der jüdischen Mitbürger reden, wissen wir, dass es um eine viel größere Erzählung geht: Es ist das Ringen um die Menschenwürde, wie es uns unser Grundgesetz aufgibt in Artikel 1, ein Ringen, das die Welt bitter nötig hat. Es ist die Verpflichtung zur Aussöhnung, auch die hat unsere Welt bitter nötig.
Und es ist die Mahnung zur beständigen und couragierten Wachsamkeit über unsere freiheitliche Grundordnung und Werteorientierung. Das sind die zukunftsgerichteten Lehren aus unserer historischen Erbschaft, die wir nicht ausschlagen können.
So setzen wir mit dem heutigen und immer wiederkehrenden öffentlichen Erinnern ein Zeichen auch mit und für die nachwachsenden Generationen, die heute bei der Namenslesung am Gedenkstein der ehemaligen Hauptsynagoge in München so zahlreich und engagiert vertreten war. Dass darunter auch viele aktive junge Soldaten der Bundeswehr, also Staatsbürger in Uniform waren, empfinde ich als besonders ermutigend.
Ich danke Ihnen allen, dass ich Ihnen diese Gedanken heute, am 9. November 2014 in München, anbieten durfte.«