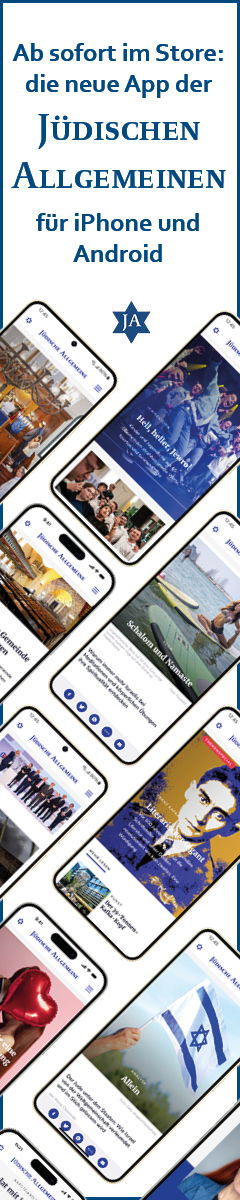Mancher Rabbiner einer mittelgroßen deutschen Stadt wäre froh über diesen regen Zulauf: jeden Freitag volles Haus zu Kabbalat Schabbat, auch wenn die Räume recht bescheiden dimensioniert sind. Gabbai Mario Wolff wartet bereits am Eingang und begrüßt jeden der Eintreffenden mit Handschlag und einem unüberhörbaren »Schabbat Schalom!«.
Die meisten Beter kennen sich gut, wohnen sie doch gemeinsam unter einem Dach, dem Jeanette-Wolff-Seniorenzentrum in Berlin-Charlottenburg. Im Gebetsraum sind bereits Rabbiner Boris Ronis und Vorbeter Porat Jacobson mit den Vorbereitungen für den Gottesdienst beschäftigt.
ritus Auch sie heißen jeden Ankömmling persönlich mit Namen willkommen, verteilen Gebetbücher und fragen die Beter auf Deutsch oder Russisch, wie es ihnen geht. Manch einer wird herzlich umarmt. »Gut Schabbes« hört man nun überall. Dann beginnt der Gottesdienst.
Gemeinsam wird der Schabbat willkommen geheißen. Der eine oder andere Nachzügler findet sich noch ein, sucht sich einen Platz und beginnt mitzubeten. »Wir folgen hier einem liberalen Ritus, so wie man ihn von der Pestalozzistraße kennt«, erklärt Rabbiner Ronis. Der Minjan ist egalitär, Frauen und Männer sitzen zusammen. »Aus Platzgründen würde es auch gar nicht anders gehen.«
Rund 20, manchmal sogar 30 Besucher kommen mittlerweile jeden Freitagabend zum egalitären Minjan, einige von ihnen wohnen nicht in dem Elternheim, sondern reisen aus der Nachbarschaft an. Am Schabbatmorgen hingegen sind es nicht ganz so viele Beter. »Aber an den Hohen Feiertagen haben wir richtig volles Haus«, ergänzt Jacobson, stolz wegen der positiven Resonanz.
initiative Dabei gibt es den Minjan im Jeanette-Wolff-Seniorenzentrum seit noch nicht einmal zwei Jahren. Trotzdem ist er für viele, gerade ältere, Beter bereits zu einer festen Einrichtung geworden. Seine Gründung geht vor allem auf die Initiative von Manfred Friedländer zurück.
»Ich wollte einfach eine Betstube, die für alle offen ist, und wo sich wirklich jeder zu Hause fühlen kann«, berichtet der langjährige Beter und Gabbai der Synagoge Pestalozzistraße. Für ihn, Jahrgang 1934 und in Berlin geboren, hat eine solche Einrichtung eine ganz persönliche Bedeutung – als Cheder und Stibl in einem.
»Es war während des Krieges, und wir lebten schon quasi in der Illegalität«, erzählt er. »Mein Vater hat sich, so oft er konnte, in dieser Zeit mit mir zusammengesetzt und mir Unterricht gegeben – Mathematik, Geschichte oder Deutsch.«
Aber am intensivsten ist ihm die Beschäftigung mit der jüdischen Religion in Erinnerung geblieben. »Die Fünf Bücher Mose waren unsere Hauptlektüre. Es ging dabei zu wie in einem richtigen Stibl – nur mit dem Unterschied, dass wir zu zweit waren.«
Stibl Mit seiner Idee vom »Stibl« stieß Friedländer bei der Leitung des Elternheims auf offene Ohren. Sie bot ihm und den anderen, die sich dafür gleichfalls begeisterten, einen Raum an, in dem früher Karten gespielt wurden.
»Zum Glück gab es mit Werner Platz und den Geschäftsleuten Heinz Rothholz und Elmar Kaplan drei Sponsoren, die uns bei unserem Projekt unter die Arme gegriffen haben«, erzählt Friedländer. Viel wurde dabei improvisiert. »Als Aron Hakodesch haben wir einen alten Büroschrank auserkoren«, lacht er. Und am ehemaligen Kartentisch stehen nun der Rabbiner und der Vorbeter. Kiddusch statt Rommé und Canasta. Aber nichts ist beständiger als ein Provisorium.
»Es sollte ein Cheder werden, wie es sie früher in einigen Berliner Vierteln wohl an jeder Ecke gegeben hat«, betont Friedländer. »Schließlich ging nicht jeder in eine richtige Synagoge, viele Juden blieben ihrem ganz persönlichen Stibl ein Leben lang treu, weil dort nach einem Ritus gebetet wurde, den sie gut kannten.«
Atmosphäre Genau dieses Konzept kommt an. »Zum einen war ich dankbar über die Möglichkeit, hier im Hause beten zu können«, bringt es Ruth Stadnik-Goldstein auf den Punkt. »Zum anderen ist es die ganz besondere Atmosphäre, die hier jeden Schabbat herrscht.« Stadnik-Goldstein selbst hat 1959 in Berlin den jüdischen Kindergarten neu gegründet.
»Auch bringt der wöchentliche Gottesdienst eine gewisse Struktur in den Ablauf unserer Woche und stellt gewissermaßen einen Höhepunkt dar.« Für viele ist es zudem eine der wenigen Möglichkeiten überhaupt, als gläubige Juden Traditionen aufrechtzuerhalten und zu pflegen.
Wie für Lea Oelsner, die seit Jahren Gedächtnistrainingskurse im Elternheim organisiert und abhält. Ihr gefällt besonders die Art und Weise, wie die Rabbiner auf die Besucher der Gottesdienste zugehen. »Sie haben etwas zu sagen, ohne dabei wie Oberlehrer aufzutreten. Genau das schätze ich sehr.«
»Für mich ist es etwas ganz Besonderes, mit diesen Menschen hier zusammenzuarbeiten«, erklärt Rabbiner Ronis. »Viele von ihnen gehören zur Gründergeneration der Jüdischen Gemeinde zu Berlin nach dem Krieg.« Sie haben Lebensgeschichten, die ihn einfach faszinieren. »So kam auch Ruth Galinski, die Witwe des ehemaligen Gemeindevorsitzenden, bis zu ihrem Tod immer wieder zu unseren Gottesdiensten.«
stammbeter Rabbiner Ernst M. Stein und seine Frau gehören ebenso zu den Stammbetern des Minjan in der Dernburgstraße, und bis zu seinem Umzug in die Schweiz schaute auch Rabbiner Tuvia Ben Chorin immer wieder gerne vorbei, erzählt Ronis.
»Der Minhag ist russisch orientiert«, sagt Rabbiner Stein. Eine Kluft zwischen deutschen und russischen Juden sollte gar nicht erst entstehen. »Wir sehen uns in einer Art Vermittlerrolle«, ergänzt Friedländer. »Denn wenn man eine wirkliche Einheitsgemeinde haben will, dann geht das nur zusammen.«
Boris Ronis sieht das genauso. Ihm ist der Minjan in der Dernburgstraße sichtlich ans Herz gewachsen. »Meine Frau beschwert sich bereits, dass ich dort immer sehr viel länger bleibe als anderswo und oft zu spät nach Hause komme.«