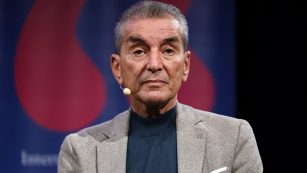von Jan Popp-Sewing
Wenn sich die Leiter der jüdischen Grundschulen Deutschlands treffen, reicht ein Tisch bequem aus, um allen Platz zu bieten. Vergangene Woche stand dieser Tisch in der Düsseldorfer Yitzhak-Rabin-Schule. Zum ersten Mal seit Jahren waren die Rektoren der jüdischen Schulen Berlin, Frankfurt am Main, München, Düsseldorf und Köln zusammengekommen. In der deutschen Bildungslandschaft sind jüdische Grundschulen zwar mittlerweile fest verankert, aber immer noch Exoten. Denn auf ihren Lehrplänen steht neben den üblichen Pflichtfächern auch die Vermittlung jüdischer Identität und der hebräischen Sprache.
Während es für Fächer wie Mathematik oder Deutsch in den einzelnen Bundesländern präzise Lehrpläne gibt, die festlegen, welches Thema wann behandelt wird, fehlt diese Systematik bei der Lehre der jüdischen Tradition, Geschichte und Religion. Ein Hauptthema der Schulleiter war daher der Vergleich der Lehrpläne und Schulprogramme untereinander, verbunden mit dem Fernziel, eines Tages einen gemeinsamen Lehrplan mit einheitlichen Lernzielen für den jüdischen Unterricht zu schaffen. Dies war das wichtigste Ergebnis der Düsseldorfer Runde. Die Schulleiter verständigten sich außerdem darauf, sich nun regelmäßig zu treffen, wenn möglich auch mit Vertretern jüdischer Schulen aus Österreich und der Schweiz.
Auch zwischen den jüdischen Ganztagsschulen bestehen große Unterschiede, hervorgerufen durch Geschichte, Lage und unterschiedliche Bildungssysteme in den einzelnen Bundesländern. Die größte Einrichtung ist die Frankfurter Lichtigfeld-Schule mit 400 Schülern und rund 50 Lehrern und Erziehern. Sie ist gerade ins his- torische Philantropin-Gebäude im Frankfurter Nordend gezogen. Dort hatte auch schon vor dem Krieg die traditionsreiche jüdische Schule mit rund 1.200 Schülern ihren Sitz. »Wir sind in sehr große Fußstapfen getreten«, sagt Konrektor Rafael Luwisch.
In der Heinz-Galinski-Schule im Berliner Stadtteil Grunewald, derzeit geleitet von Miron Schumelda, werden 283 Kinder unterrichtet. Sowohl in Frankfurt als auch in Berlin haben die Schüler die Möglichkeit, an einer jüdischen Schule Abitur zu machen beziehungsweise sich bis zum Abitur begleiten zu lassen. In Berlin können Schüler an einen Realschul- oder gymnasialen Zweig wechseln. Die Frankfurter Schule geht mittlerweile bis Klasse neun, danach können die Schüler in die Oberstufen örtlicher Gymnasien wechseln, mit denen die Lichtigfeld-Schule kooperiert.
160 Kinder besuchen zurzeit die Düsseldorfer Yitzhak-Rabin-Schule. Sie wurde 1993 gegründet und wird von Heidelinde Foster geleitet. Auf die Münchner Sinai-Schule von Rektorin Antonia Ungar gehen 122 Kinder. Ab dem neuen Schuljahr ist eine Aufstockung der Münchner Schule auf 250 Schüler vorgesehen. Die Kölner Lauder-Morijah-Schule – Leiterin: Dagmar Höhnen – besteht erst seit fünf Jahren und liegt im Stadtteil Ehrenfeld. Sie besuchen 82 Kinder.
Am 1. September soll auch die Hamburger Joseph-Carlebach-Schule als zweizügige Grundschule wiedereröffnet werden. Sie war 2005 nach nur dreijährigem Betrieb von der Gemeinde wegen zu geringer Schülerzahlen geschlossen worden.
Das macht zusammen aktuell knapp 1.050 Schüler an jüdischen Grundschulen. Diese haben sich mittlerweile auch über die Gemeinden hinaus einen Namen gemacht. Das beweist schon das große Interesse von Eltern nichtjüdischer Schüler, die an den jüdischen Schulen auch unterrichtet werden, wenngleich ihr Anteil begrenzt ist.
Unterschiede zwischen den jüdischen Schulen zeigen sich auch in der Organisation der Nachmittagsbetreuung. Die Schulen haben dafür neben den eigenen Erziehern verschiedene Partner mit ins Boot geholt: von den Jugendzentren, den Horten der jüdischen Gemeinden über örtliche Makkabi-Vereine bis zu nichtjüdischen Vereinen oder Trägern. Meist ist das Ergebnis eine Kombination, wie in Frankfurt, wo sich der Verein »Kaleidoskop« um die Nachmittagsbetreuung kümmert und Makkabi die sportlichen Angebote übernimmt. Auch die Dauer der Betreuung differiert: Während Kinder in München bis 17 Uhr beaufsichtigt werden können, fahren in Berlin bereits um 15.30 Uhr die Schulbusse vor.
Ein wichtiger Punkt ist auch das Engagement der Eltern. In Frankfurt gibt es sogar zwei Fördervereine: einer für die Schule, einer für den Aufbau des gymnasialen Zweigs. In der jungen Kölner Schule hingegen steht das Thema gerade erst auf der Tagesordnung. Auch die finanzielle Beteiligung der Eltern wird unterschiedlich gehandhabt. In Frankfurt beträgt das Schulgeld von 260 bis zu 330 Euro im Monat, in Düsseldorf sind Unterricht und Fahrdienst kostenlos.
Neben diversen graduellen Unterschieden gibt es aber einige zentrale Herausforderungen, denen sich alle Schulen gleichermaßen stellen müssen. Etwa dem Um- stand, dass auf Schüler jüdischer Grundschulen durch den Unterricht in Hebräisch und jüdischer Tradition mehr Lernstoff zukommt als auf Schüler an staat- lichen Schulen. Und da die jüdischen Schulen sowohl an jüdischen als auch christlichen Feiertagen geschlossen sind – und es natürlich keinen Samstags-Unterricht gibt –, haben Lehrer und Erzieher auch weniger Unterrichts-Tage zur Verfügung, um den Lernstoff zu vermitteln. Hinzu kommt oftmals noch die Notwendigkeit, spezielle Deutsch- und Russisch-Kurse für Zuwanderer-Kinder anzubieten.
Die Schulleiter konzentrierten sich bei ihrem Treffen auf pädagogische und organisatorische Fragen. Viele Details gab es zu besprechen. So hörten die anderen Rektoren etwa interessiert zu, als Rafael Luwisch berichtete, dass Jugendliche an der Lichtigfeld-Schule jetzt auch ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren können. Eine wichtige Unterstützung durch engagierte junge Leute, die vielleicht auch anderen Schulen zugute kommen könnte. Die finanziellen Probleme der jüdischen Bildungsstätten, deren Betrieb in der Regel wesentlich höhere Mittel erfordert, als die Länder zuschießen, blieben bei diesem Treffen noch ausgeklammert.
Das nächste Mal wollen sich die Schulleiter in einem halben Jahr in Berlin an einen Tisch setzen.