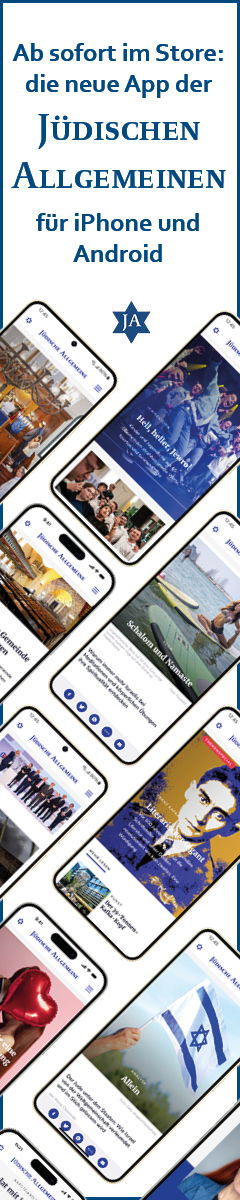Am Ausgang der Metrostation Dorogoshytschi riecht es nach Gegrilltem, in einer Dönerbude dreht sich ein Hühnerspieß. Unter den Werbeschirmen einer lokalen Brauerei sitzen die ersten Gäste beim Vormittagsbier und blinzeln in die September- sonne. Rundherum tost der Verkehr zwischen den Plattenbauten des beliebten Wohnbezirks. Direkt hinter der Imbissbude beginnt ein Weg aus Betonplatten. Die schattige Allee führt durch einen Park aus hohen Birken, Buchen und Kastanien.
Doch dies ist kein gewöhnliches Naherholungsgebiet. Keine fünf Meter vom Dönermann steht ein verstörendes Denkmal: Auf einem angebissenen Kuchen aus rotem Stein hocken drei unendlich traurige Bronzefiguren – überdimensionale Puppen mit verrenkten Gliedern. Das Denkmal erinnere an die ermordeten Kinder von Babi Jar, erklärt Rabbi Alexander Duchowny. Der Vorsitzende der progressiven jüdischen Gemeinden der Ukraine führt ab und zu Besucher über das Gelände. Aus einem Schnellhefter holt er die Kopie eines Schwarz-Weiß-Fotos: Entstanden Anfang der 30er-Jahre, zeigt es eine karge, zerklüftete Landschaft vor den Toren der Stadt: die Schlucht von Babi Jar.
Genau diesen abgelegenen Ort hatten sich die Einsatzgruppen des Sicherheitsdienstes der Wehrmacht für eine der größten Mordaktionen im Zweiten Weltkrieg ausgesucht. Kurz nach der Einnahme Kiews erschossen hier am 29. und 30. September 1941 mobile SS-Truppen fast die gesamte verbliebene jüdische Bevölkerung: 33.771 Männer, Frauen und Kinder, die zuvor per Befehl zu einer »Evakuierungsaktion« beordert worden waren, starben im Kugelhagel deutscher Maschinenpistolen. Die Wehrmacht sperrte den Er- schießungsort ab und sprengte nach dem Massaker Teile der Schlucht, um die Leichen mit dem Schutt zu bedecken. Bis zum Ende der deutschen Besetzung Kiews kam es in der zweieinhalb Kilometer langen und rund 50 Meter tiefen Schlucht zu weiteren Massenerschießungen, bei denen auch sowjetische Kriegsgefangene, Ukrainer und Roma getötet wurden: schätzungsweise insgesamt 120.000 Menschen (vgl. S. 15).
scheiterhaufen Nach der Niederlage in Stalingrad kehrten die Deutschen mit einem Sonderkommando noch einmal nach Babi Jar zurück – um vor der anrückenden Roten Armee Spuren zu verwischen. Kriegsgefangene mussten die Leichen zu Scheiterhaufen auftürmen und verbrennen, die Asche verstreuen. »Danach wurden die meisten als Mitwisser erschossen«, erzählt Duchowny, der fünf Verwandte in Babi Jar verlor und sich mit der Geschichte des Ortes eingehend beschäftigt hat.
Längst sind die Ränder der Schlucht eingeebnet. »Früher wuchs hier kein Baum, kein Strauch«, sagt Duchowny und deutet auf den dichten Wald beiderseits des Weges. Erst die Asche der Toten habe die karge Erde fruchtbar gemacht.
In den 70er-Jahren entschied die Stadt, diesen Höllenschlund in ein Naherholungsgebiet umzuwandeln. Duchowny zeigt den Spielplatz, und eine Bühne, auf der im Sommer Freiluftkonzerte stattfinden. Mütter schieben Kinderwagen übers Gelände. Ein Mädchen spielt Ball mit der Großmutter. Jogger laufen ihre Runden, Hundebesitzer auch.
»Natürlich weiß ich, was hier Entsetzliches geschehen ist«, sagt Rentnerin Alexandra, die auf einer Parkbank sitzt, und legt ihr Kreuzworträtsel beiseite. »Der Park ist für uns einfach praktisch«, meint Alexandra und deutet auf den Kinderwagen, in dem Enkelsohn Dima schläft. »Wir wohnen ganz in der Nähe, und dies ist unsere grüne Lunge.«
partyzone Doch nicht alle gehen mit der grünen Lunge pfleglich um. Überall liegt Müll herum: Kognak- und Wodkaflaschen, Tomatensafttüten, zerdrückte Zigarettenschachteln. Natürlich müsse man die Würde des Ortes achten, mischt sich eine ältere Frau ein, die mit ihrer Nachbarin den Altweibersommer genießt. Nur »dumme Menschen« träfen sich hier zum Feiern, sagt sie. »Wir tanzen nicht, wir trinken nicht, wir ruhen uns nur aus.« Auf der Bank gegenüber stapelt ein Junge in Latzhose Kastanien, die er im ersten Herbstlaub findet. Auch seine Mutter Daria mag den Park: »Wenn das Wetter schön ist, sind wir jeden Tag hier draußen. Die Luft ist viel besser«, schwärmt die 32-Jährige. Nein, ein seltsames Gefühl sei es nicht, sich an diesem besonderen Ort zu erholen. »In der Nähe gibt es sonst kein Fleckchen Grün. Und die Geschichte kann man nicht ändern«, sagt sie und zuckt mit den Schultern.
Für den jüdischen Historiker Boris Zabarko ist es keine Überraschung, dass Babi Jar bei vielen Kiewern eher als Naherholungsgebiet gilt denn als Ort jüdischen Leidens. Der staatliche Antisemitismus während des Spätstalinismus habe lange eine Memorialisierung verhindert. Alle Bemühungen, ein Mahnmal zu errichten oder Gedenkveranstaltungen durchzuführen, seien unterbunden worden, erinnert sich Zabarko, der auch Vorsitzender des ukrainischen Verbandes der jüdischen Ghetto- und KZ-Überlebenden ist. Der 1961 missglückte Versuch, auf dem Gelände von Babi Jar einen Staudamm anzulegen, wie auch Pläne für einen Freizeitpark auf den Massengräbern zeigten eindrücklich, dass ein Holocaustgedenken in der Sowjetunion nicht möglich war. »Das jüdische Leiden musste sich einem sowjetischen Opfermythos unterordnen«, sagt Zabarko. Das 1976 in Babi Jar eingeweihte Mahnmal, das jenseits der U-Bahn-Station an die getöteten »Sowjetbürger« erinnert, und immer noch von vielen Schulklassen zuerst besucht wird, steht bis heute für diese Erinnerungskultur.
ruhe Erst mit der Unabhängigkeit der Ukraine ab 1991 änderte sich die Situation. Ein weiteres Mahnmal kam hinzu. Auf einer kleinen Anhöhe erinnert eine bronzene Menora an den Massenmord. Inlineskater umkreisen das erst vor Kurzem renovierte Marmorpodest, auf dem ein Gesteck in den israelischen Nationalfarben liegt. Im Frühjahr war das Denkmal von Unbekannten verwüstet worden. Rechtzeitig zum Gedenkmarsch der Babi-Jar-Überlebenden Ende September haben jüdische Geschäfts- leute für die Instandsetzung gespendet.
Ganz in der Nähe der Menora lag bis zum Zweiten Weltkrieg der berühmte jüdische Friedhof Lukjanowski, einst das Pantheon der größten jüdischen Philanthropen der Stadt. »Früher hieß es: Wenn nicht in Jerusalem, dann sollst du auf dem Lukjanowski-Friedhof deine Ruhe finden«, weiß Rabbi Duchowny und zeigt, was übrig geblieben ist: Einige dutzend Fundamente, die Steine allesamt abgebrochen und verschwunden. Nur noch eine halbe Inschrift ist zu entziffern: Samuel Richter, gestorben 1935. Als der Park angelegt wurde, bot die Stadt an, die Toten auf städtische Friedhöfe umzubetten. Doch kaum ein Angehöriger der hier Bestatteten hatte den Krieg überlebt. So wurden die meisten Grabstellen eingeebnet. Später wurde auf dem Gelände das Betonungetüm des Kiewer Fernsehzentrums hochgezogen.
Juden in Kalifornien haben vor einigen Jahren eine Gedenkplatte für den Friedhof montiert. Direkt daneben liegen kalte Asche, eine leere Chipstüte – Spuren eines weiteren, nächtlichen Gelages. Auf dem Rückweg rollt ein Traktor die Hauptallee entlang: Städtische Angestellte laufen mit Körben nebenher, leeren die Mülltonnen. Die Stadt bemüht sich, den Park sauber zu halten. Inzwischen steht die Sonne hoch am Himmel. Auf den Bänken sitzen jetzt Schüler, sie tippen SMS, kichern. Verliebte Paare sind eng zusammengerückt, Bierflaschen kreisen, Musik plärrt aus MP3-Playern. Rabbi Duchowny beobachtet die Szenerie mit gemischten Gefühlen: »Einerseits ist es schön, dass das Leben weitergeht, andererseits macht es mich traurig, dass viele, die hierherkommen, wenig darüber wissen, was hier passiert ist.«