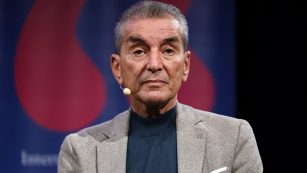von Michael Wuliger
Julius Meyer, Häftlingsnummer 103889, wurde am 2. Mai 1945 von der Sowjetarmee aus dem KZ Ravensbrück befreit. Der gelernte Kaufmann kehrte nach Berlin zurück, wurde KPD-Mitglied und arbeitete beim Ernährungsamt der Stadt. Gleichzeitig betreute er zusammen Heinz Galinski andere Überlebende der Schoa und setzte sich erfolgreich dafür ein, dass sie versorgungsrechtlich mit Widerstandskämpfern gleichge- stellt wurden. 1946 wurde Meyer Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Ostberlin. Bei der ersten Volkskammerwahl 1949 zog er als Abgeordneter in das DDR-Parlament ein. Doch dann drehte sich der Wind. Stalin startete in der Sowjetunion und in den Satellitenstaaten eine offen antisemitische Kampagne gegen »wurzellose Kosmopoliten« und »zionistische Agenten«. Auch Julius Meyer geriet ins Visier. 1953 musste er in den Westen fliehen. Doch in der Bundesrepublik war der ehemalige SED-Mann suspekt. Die Anerkennung als politischer Flüchtling und die Wiedergutmachung wurden ihm verweigert. Meyer ging nach Brasilien, wo er 1979 starb.
Julius Meyer ist einer von acht Juden in Ostdeutschland, deren Lebenswege das Centrum Judaicum jetzt in einer Ausstellung exemplarisch präsentiert: die Unternehmer Otto Ephraim und Josef Jubelski, der Hotelier Adalebert Bela Kaba-Klein, der Polizeioffizier Fritz Katten, die jüdischen Gemeindefunktionäre Julius Meyer und Erich Nelhans, die Tänzerin Eva Robinson, der Betriebsleiter Ernest Wilkan, der Bürgermeister Karl Wolfsohn und der Staatssekretär im Präsidialamt der DDR Leo Zuckermann. Sie alle hatten die Schoa überlebt, in der Emigration, im KZ, versteckt oder geschützt durch eine »privilegierte Mischehe«. Sie alle hatten nach der Befreiung ihre Hoffnungen auf den proklamierten »antifaschistischen Neubeginn« gesetzt. Sie alle gerieten stattdessen als »feindliche Elemente« in die Mühlen der sowjetischen und DDR-Politik. Manche flohen in den Westen, andere verloren ihre Stellung, wieder andere kamen ins Zuchthaus, das nicht alle überlebten.
Hintergrund war der nach anfänglicher Unterstützung Israels durch die Sowjet-union bald zunehmend antizionistische Kurs des sozialistischen Lagers. Juden galten jetzt als potenzielle feindliche Agenten. In der DDR kam der Streit um die Wiedergutmachung hinzu . Während eine Minderheit in der SED-Führung um das Politbüromitglied Paul Merker aus moralischen Gründen eine Restitution »arisierten« jüdischen Eigentums forderte, ging die Parteiführung um Walter Ulbricht die Frage »klassenmäßig« an: Kapitalist war Kapitalist, ob jüdisch und verfolgt oder auch nicht.
Der junge Historiker Andreas Weigelt, der die Ausstellung kuratiert, hat sich ein faszinierendes und noch immer unterbeleuchtetes Kapitel deutscher Geschichte zum Thema gewählt. Leider hat er es jerdoch ästhetisch etwas dürftig umgesetzt. Die kleine Schau in nur einem Saal strahlt den Charme einer provinziellen Volkshochschule aus: Stellwände mit Fotos, Daten, Namen und Zahlen, äußerst wenige Originalexponate, meist Bücher oder Zeitungen, dazu in einer einzigen und kleinen Videostation Ausschnitte aus alten DDR-Wochenschauen. So macht man, mit Verlaub, seit 30 Jahren keine Ausstellungen mehr. Gewiss, das Centrum Judaicum hat nicht so viel Geld wie die Konkurrenz vom Jüdischen Museum Berlin. Dessen gelegentlich ins allzu Bunte ausufernde Gestaltungsfreude muss man auch nicht unbedingt nachahmen. Aber ein bisschen publikumsfreundlichere und ästhetisch ansprechendere Ausstellungen als diese muss man den Zuschauern heute schon anbieten. Sonst bleiben sie weg. Und das wäre angesichts des wichtigen und spannenden Themas schade.
»Zwischen Bleiben und Gehen. Juden in Ostdeutschland 1945 bis 1956. Zehn Biografien«, Centrum Judaicum Berlin, Neue Synagoge, Oranienstraße. Zur Ausstellung ist ein gleichnamiges Buch von 248 Seiten im text.verlag Berlin zum Preis von 16,90 € erschienen.
www.cjudaicum.de
.