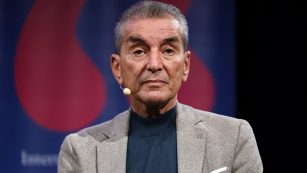von Rabbinerin Irit Shillor
Vor einigen Jahren fand sich in den Zeitungen die Geschichte eines Paares, das im brasilianischen Urwald entdeckt worden war und eine Sprache sprach, die niemand je zuvor gehört hatte. Von der brasilianischen Indianerschutzbehörde wurden sie als »isolierte Ureinwohner« bezeichnet – Eingeborene abgelegener Amazonasgebiete, die noch keinerlei Kontakt zur modernen Zivilisation hatten.
Im Lauf der vergangenen Jahre fand man offenbar Dutzende solcher isolierter Stammesgemeingemeinschaften, und es war gängige Praxis, diese Menschen in Frieden zu lassen, um ihre Kultur und Lebensweise nicht durch den Kontakt mit der Zivilisation zu beeinträchtigen. In diesem Fall war die Lage indes eine andere. Das Land, auf dem das Paar lebte, war Privatbesitz und wurde, wie ein Großteil des Regenwaldes, zunehmend von Bauern, Viehzüchtern und Holzhändlern in Beschlag genommen. Das Heim der Eheleute würde schließlich ebenfalls der Brandrodung oder dem Bulldozer zum Opfer fallen. Das Beste, was die Behörde zu ihrem Schutz tun konnte war, sie aus ihrem angestammten Lebensraum herauszunehmen und sie in einem Reservat am Rand einer Stadt anzusiedeln.
Das ist eine traurige Geschichte über die letzten Angehörigen eines Volkes und den Tod seiner Kultur. Als Angehörige eines jahrtausendealten Volkes waren diese beiden Menschen die letzten ihres Stammes. Ein Volk, das immer in enger Verbindung zu seinem Land gelebt hatte, wurde nun endgültig zerstört. Mit diesen beiden Menschen endet die Geschichte ihres Volkes.
Sicher geschah das so nicht zum ersten Mal, und ich vermute, es ist auch nicht das letzte Mal gewesen. Man kann sich kaum vorstellen, wie dieses Ehepaar sich gefühlt haben muß, man kann nur spekulieren, ob die beiden sich im Klaren darüber waren, daß dies das Ende ihres Stammes war. Wer kennt schon ihre Vergangenheit? Wenn sie erst verschwunden sind, wird kein Mensch etwas darüber erfahren.
Rabbiner Pinchas Peli vertritt in seinem Kommentar zum Wochenabschnitt dieser Woche die Auffassung, es sei besser, der erste als der letzte in einer Abstammungslinie zu sein. Das jüdische Volk ist ein Volk, das Gott sei Dank überlebt hat, manchmal auf geradezu an Wunder grenzende Art. Wir sind ein Volk, das ebenfalls mit einem Land verbunden ist, und unser Land wurde uns immer wieder entrissen. Wir haben es geschafft, zu überleben und uns immer wieder in unserem Land niederzulassen. Aber wir waren nie ein »isoliertes« Volk. Wir mußten hinausziehen in die Welt und von Ort zu Ort wandern. Wir haben aus unseren Erfahrungen gelernt und wissen, wie wir mit anderen zusammenzuleben haben.
Und noch wichtiger: Ganz gleich, wohin wir gingen, unsere Vergangenheit haben wir immer mit uns genommen. Hier liegt sehr wahrscheinlich das Geheimnis unseres Überlebens. Wir waren nicht nur an ein Land gebunden, sondern auch an eine Geschichte und an die Texte, die unsere Vergangenheit festhalten. Wie groß auch die Bedrohung war – indem wir unsere Vergangenheit nicht vergaßen und sie unsere Kinder lehrten, haben wir uns selbst eine Zukunft erhalten.
Unser großer Lehrer Moses hat die Bedeutung der Geschichte sehr klar begriffen. Deshalb verwendete er seine letzten Tage, Stunden und Minuten auf den Versuch, die Kinder Israel, die kurz davor standen, zum ersten Mal als Volk ihr eigenes Land zu betreten, über ihre Vergangenheit aufzuklären. Er wollte dafür sorgen, daß sie eine Zukunft hatten.
Der Wochenabschnitt Haasinu enthält Moses’ letzte Worte an die Israeliten, es ist ein Gedicht und wird als Lied gesungen: Diese Worte rekapitulieren noch einmal die heilige Geschichte des Volkes seit dem Auszug aus Ägypten und ermahnen die Israeliten in der denkbar strengsten Weise, nicht vom gottbefohlenen Weg abzuweichen.
»Als nun Moses alle diese Worte zu ganz Israel zu Ende geredet hatte, sprach er zu ihnen: Richtet euer Herz auf alle die Worte, die ich heute gegen euch bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, bedacht zu sein, alle Worte dieser Weisung zu üben. Denn es ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben, und durch dieses Wort werdet ihr lange leben auf dem Boden, dahin ihr den Jarden durchschreitet, um ihn in Besitz zu nehmen.« (5. Buch Moses, 32, 45).
Im Midrasch Sifre steht geschrieben »Dieses Lied ist ein großes Lied, denn es hält an der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft fest.« Wie Moses uns in Haasinu sagt, ist es wichtig, daß wir unsere Geschichte erzählen: unseren Kindern und uns selbst und jedermann, der sie hören will. So sichern wir uns eine Zukunft. So wird nie der Fall eintreten, daß wir die letzten eines ausgelöschten Volkes sind.
Hier spricht Moses, der Prophet, der die ganze Welt zum Zeugen der Wahrheit dessen aufruft, was er zu sagen hat. Seine Worte richten sich nicht nur an die Israeliten, sondern an alle Menschen. Was aber sagt er zu den Israeliten selbst? Ein großer Teil von Moses’ Lied besteht in einer Ermahnung an uns. Ganz ähnlich wie die Liturgie unserer Hohen Feiertage führen uns die Worte seines Liedes zur Reue. Zugleich bietet uns Moses’ Lied, wie ein großer Teil der Liturgie für die Jamim Noraim, Hoffnung und weist uns einen Weg, auf dem wir uns eine bessere Zukunft schaffen können.
Moses’ einzigartiges Lied umfaßt die gesamte Geschichte der Juden. Es berichtet von der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft unseres Volkes. Wie die Worte unseres Machsor umfaßt es das gesamte jüdische Dasein.
Wir lesen Haasinu am Schabbat Tschuwah, dem Schabbat der Reue. Der Talmud sagt, daß schon die Leviten dieses Lied am Schabbat im Tempel sangen (Babylonischer Talmud, Rosh HaShanah 31a). Mit den überschäumenden Melodien von Rosch Haschana noch im Ohr und den heiligen Anstrengungen von Kol Nidre und Jom Kippur nur Tage entfernt, sind viele Juden zu dieser Zeit unseres liturgischen Kalenders besonders von Musik erfüllt. Hier haben wir den ältesten musikalischen Ausdruck vor uns, und er hat die Kraft zu begeistern, zu gedenken, zu trösten, zu heilen und zu lehren. Im jüdischen Leben ändern sich der Nussach oder die Gebetsmelodien, um die jeweilige Zeit des Jahres widerzuspiegeln. Unsere Liturgie in dieser Zeit des Jahres wird durch die Motive der Anstrengungen während der Hohen Feiertage noch schöner.
Moses’ Lied, rezitiert zwischen Rosch Haschana und Jom Kippur, erinnert uns daran, daß Gott mit uns ist und uns leitet, genau wie Moses auf seiner geistlichen Reise geleitet wurde. Und das Lied, das in unseren Synagogen erklingt, erinnert uns daran, daß wir noch immer da sind. Wir haben nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch eine Zukunft. Wir sind nicht die letzten, die dieses Lied singen.
Haasinu: 5. Buch Moses 29,9 - 31,30