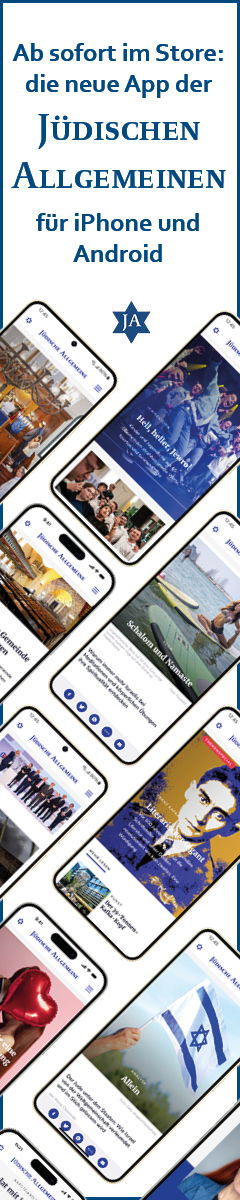von Thomas Lackmann
24 Jahre lang hatte das Denkmalkomitee gesammelt: 1892 war der drei Meter hohe Felix Mendelssohn Bartholdy vor dem Neuen Gewandhaus eingeweiht worden. 1923 wurde eine der Bronzeplatten, die am Sockel weltliche und kirchliche Musik symbolisieren, gestohlen; kurz darauf waren die Diebe gefasst. Dann kommt das Jahr 1936. Im Mai fordert eine Leipziger NSDAP-Dienststelle: Der »Jude in Erz« gehöre ins Museum, die Bevölkerung denke »zum weitaus größten Teil gut nationalsozialistisch«. Oberbürgermeister Carl Goerdeler lehnt ab. Im August beantragt der NS-Presseverband die Überstellung der Statue an den Jüdischen Kulturbund. Als Goerdeler auf Dienstreise ist, lassen Bürgermeister Haake und Stadtbaurat Lüdeke das Denkmal abreißen, in der Nacht vom 9. auf den 10. November. »Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler«, hatte Robert Musil im selben Jahr geschrieben.
Goerdeler kann die Wiedererrichtung des Denkmals nicht durchsetzen und tritt daraufhin zurück. Im Ausland rufen Flugblätter zum Boykott der Leipziger Messe auf. Ein Amerikaner bietet, vergeblich, den anderthalbfachen Schrottwert zum Tausch für die Figur. Ein Steinmetz kauft 1942 den Granitsockel für 150 Mark. Nach dem »20. Juli« wird Goerdeler als Verschwörer hingerichtet. Haake und Lüdeke begehen beim Einmarsch der US-Armee Selbstmord. Das Denkmal bleibt verschollen, wurde wohl eingeschmolzen als »Metallspende des Deutschen Volkes an den Führer«.
Nun ringt die Heldenstadt seit sieben Jahren darum, ihren Felix, Baujahr 1892, neu zu errichten. 2003 haben Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee und Gewandhaus-Ehrendirigent Kurt Masur sich auf dieses Ziel verständigt. Ein Sponsor, das Regierungspräsidium, die Stadt und das Museum Mendelssohn-Haus tragen die Kosten in Höhe von 355.000 Euro. Ein Denkmal, das vielen Zeitgenossen im Sinne Musils schon »unsichtbar« erschienen war, wird neu sichtbar – aufgrund seiner rassistisch motivierten Zerstörung.
Dabei geht es seinen Befürwortern um mehr als die politische Geste. Sie wollen korrigieren, dass der »Komponist, Kosmopolit und Mittler zwischen den Religionen« im Stadtbild nicht wahrnehmbar sei: jener geniale Jüngling, der als 27-Jähriger nach einjährigem Wirken in der alten Universitätsstadt den philosophischen Ehrendoktor erhielt; der Begründer des Konservatoriums, Pionier der Musiker-Ausbildung, Neuentdecker Bachs, der Ehrenbürger des Jahres 1843, Stifter des ältesten Bachdenkmals südwestlich der Thomaskirche. In dessen Nachbarschaft soll am 18. Oktober die geklonte Statue enthüllt werden – und nicht an ihrem Original-Standort vor dem zerstörten Gewandhaus, wo sich heute ein Uni-Neubau für Geisteswissenschaften befindet.
Dort steht bereits Walter Arnolds nach der Totenmaske des Musikers geschaffene Porträt-Stele. Diese »Entsühnung der faschistischen Freveltat«, so Oberbürgermeister Ernst Zeigner bei der Enthüllung 1947, markiert, abseits des heutigen Stadtkerns, im öffentlichen Raum (neben einer Mendelssohn-Straße) die einzige Erinnerung an den Berliner, der vor Preußens Kulturpolitik nach Sachsen geflohen war. Andere Reminiszenzen sind durchaus aufzuspüren: Porträtreliefs an der Fassade des Mendelssohn-Hauses sowie eines im Eingangsbereich, das an den Tod des 38-Jährigen 1847 erinnert und während des »Dritten Reiches« verputzt war; im Museumsgarten eine moderne Büste samt »Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Rose« von 1997. Und im neuesten, modernen Gewandhaus ein Mendelssohn-Saal sowie – eine Statue!
Diese Bronze Jo Jastrams war 1993 auf dem Vorplatz errichtet und (»Wir treffen uns am Felix«) ein beliebter Treffpunkt geworden – bis das Gewandhaus sie für sein Foyer rekrutierte. Außerdem erscheint der Musiker in der Thomaskirche als Glasmalerei (1997), zwischen Luther und Kaiser Wilhelm I. Nebenan zeigt sich, was passiert, wenn Denkmal-Freunde auf Quantität setzen und klotzen: Das poetisch-zarte alte Bachdenkmal aus Elbsandstein in Tabernakel-Form von 1843 wird ein paar Meter weiter übertrumpft durch den Johann-Sebastian-Bach-Koloss von 1908, der wie eine zur Bronze erstarrte Toccata das Kirchenportal überschattet.
Beim Kampf der Felix-Fans um die Denkmal-Wiederherstellung stand ihr Plädoyer für den kommunikativen Standort im Mittelpunkt. Am 10. Juli 2008 votierte der Stadtrat für den Platz an der Thomaskirche.
Bei den Gegenargumenten hatten in den Jahren zuvor ästhetische Bedenken überwogen: So ein altes, nachgemachtes Denkmal passe nun mal nicht zum neuen Leipzig. Richig verdruckst wurde die Debatte durch den historischen Kontext. Offen seien jene Ressentiments, die dem Widerspruch zugrunde lagen, nicht artikuliert worden, sagen Beobachter, die keinesfalls zitiert werden möchten. Der Antisemitismus-Vorwurf steht im Raum und bleibt tabu. Dass der Enkel des Philosophen Moses mit sieben getauft worden war, spielt auf dieser unterschwelligen Ebene so wenig eine Rolle wie die Pietät des Kirchenkomponisten für seinen jüdischen Opa. Selbst historisch versierte Denkmal-Freunde, denen es weniger um den »Juden in Erz« geht als um eine Leipziger Persönlichkeit, konnten zufrieden sein, dass ihr Vorhaben über das »jüdische Ticket« doch ans Ziel gelangt ist.
Mit Werner Steins Statue von 1892 kehrt, samt lebensgroßer Muse und musizierenden Putten zu ihren Füßen, eine Gründerzeit-Figur mit Toga ans Licht der Öffentlichkeit zurück, die den Frühvollendeten als kraftvollen antiken Lehrer stilisiert. Leipziger Nachkriegsdarstellungen Mendelssohn Bartholdys betonen dagegen eher das elegisch-ätherische Genie. Ein Bronzeklon zur nostalgischen Wiedergutmachung?
Provokative Bearbeitungen unbeschönigter Erinnerung wie zum Beispiel in Kassel, wo Horst Hoheisel den von Nazis demontierten »jüdischen« Aschrottbrunnen 1987 als begehbare Negativform in die Erde versenkte, hätte die Messestadt schwer verkraftet. Jetzt ragt hinter ihrem alt-neuen Felix das »Hotel Kosmos« empor; davor duckt sich das Kabarett Pfeffermühle. Auf dem Weg zum alten Bachdenkmal nebenan übersieht man fast an der Kirchenmauer die Gedenktafel für einen Minnesänger, verstorben hierselbst anno 1220. Leipzig hat sich schon öfter neu erfunden.