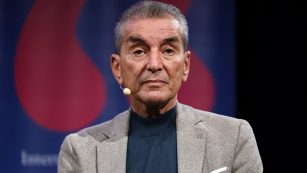von Michael Wuliger
Wenn von Friedrich Torberg (1908–1979) die Rede ist, fällt den meisten Lesern als Erstes die Tante Jolesch ein, jene wundervolle Anekdotensammlung, die das von den Nazis weggemordete deutsch-jüdische Prager Milieu und die Wiener Kaffeehausgesellschaft der Zwischenkriegszeit wiederauferstehen ließ. Aber Torberg, der an diesem 16. September 100 Jahre alt geworden wäre, war mehr als ein genialer Geschichtenerzähler. Er war ein ernsthafter Romancier, dessen von der Kritik hochgelobtes Erstlingswerk Der Schüler Gerber, das er mit gerade 22 Jahren veröffentlichte, ein Sensationserfolg war; es folgten 1932 ... und glaubten, es wäre die Liebe und 1935 der Sportroman Die Mannschaft. Im amerikanischen Exil entstanden die Novelle Mein ist die Rache und der Roman Hier bin ich, mein Vater, die sich mit jüdischem Leben und Leiden unter dem Nazismus befassen, ein Thema, das Torberg 1950 mit Die zweite Begegnung fortführte. Sein letzter Roman Süßkind von Trimberg 1972 leitete die Wiederentdeckung des jüdischen Minnesängers aus dem Mittelalter ein.
Torberg war aber auch ein Lyriker, dessen in den USA enstandene Poeme Kaddisch 1943, Sehnsucht nach Altaussee und Seder 1944 zu den, so das Metzler-Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur, »wichtigs-ten jüdischen Exilgedichten überhaupt« zählen. Und da ist der Theaterkritiker Torberg, der, 1951 in seine Geburtsstadt Wien zurückgekehrt, dort in den 50er- und 60er-Jahren über Sein oder Nichtsein jeder Neuinszenierung entschied. Gelernt hatte er sein Handwerk beim legendären Prager Tageblatt, wo Egon Erwin Kisch, Alfred Polgar und Joseph Roth seine Kollegen waren. Ebenso gefürchtet wie Torbergs Theaterkritiken waren die wüsten, oft persönlich gehaltenen Polemiken, die er in seiner CIA-finanzierten Zeitschrift FORVM gegen tatsächliche oder vermeintliche Kommunisten und deren linksliberale Apologeten richtete. Nicht nur Brecht und Sartre, auch ihm missliebige Mitjuden wie Salcia Landmann oder Hilde Spiel machte Torberg gnadenlos nieder – der Henryk Broder seiner Ära. Bei all diesen Aktivitäten blieb ihm immer noch die Zeit, nebenher Ephraim Kishon ins Deutsche zu übersetzen.
Immer schwang das Jüdische dabei nicht nur mit, sondern gab den Ton an. Für Torberg war, anders als für viele andere jüdische Autoren seiner Generation, das Judentum nicht bloß ein Zufall der Geburt. Es prägte ihn und sein Werk. Zwar war er nicht religiös, stand, wie er sagte, »zum lieben Gott bestenfalls in einem Verhältnis wohlwollender Neutralität«. Aber das tat der Treue zu seinen Wurzeln keinen Abbruch: »Ich gehöre weder zu jenen Juden, die erst den Hitler gebraucht haben, um dahinterzukommen, dass sie es sind, noch auch zu jenen, die es sich von Hitler ›nicht vorschreiben‹ ließen.«
Geprägt wurde diese Haltung weniger in Torbergs assimiliertem Elternhaus, sondern vor allem in der jüdischen Sportbewegung. Der junge Friedrich war aktives Mitglied des berühmten Wiener Sportklubs Hakoah, wo er zu den Stars der Wasserballmannschaft zählte. Ruppiges Spiel gehörte zu deren Markenzeichen: »Wir wollten die antisemitische Lüge von der körperlichen Minderwertigkeit und Feigheit der Juden entlarven. Dieser Beweis ist uns überzeugend gelungen«, erinnerte er sich noch 30 Jahre später stolz an Rempeleien und Bodychecks im Schwimmbecken.
Torbergs Verachtung galt den überassimilierten verschämten Juden, die am liebsten Gojim gewesen wären. In Hier bin ich, mein Vater erzählt er die Geschichte des Juden Otto Maier, der zum Nazispitzel wird, um seinen im KZ inhaftierten Vater zu befreien. Für Torberg ist Maiers würdeloses Verhalten auch ein Ergebnis dieser Mentalität: »Immer und seit je ist es mir doch nur darum gegangen, von den andern, die keine Juden waren, so behandelt zu werden, als ob auch ich keiner wäre; so behandelt zu werden, wie ein normaler Mensch«, lässt er Maier sagen. »Ich habe mein Judentum immer als Defekt akzeptiert, und die es mich fühlen ließen, immer als Ankläger. Ich habe nie zu vermuten gewagt, dass da vielleicht die Ankläger selbst an einem Defekt litten.«
Diesen »Defekt« diagnostizierte Torberg auch am liberalen Nachkriegsphilosemitismus, den er in seinem Essay Das philosemitische Missverständnis als Antisemitismus mit umgekehrtem Vorzeichen be- zeichnete, der »den Juden als Deutschen, als Menschen, sogar als Christen (akzeptiert) – als alles, nur nicht als Juden«. In diesem Sinn verriss Torberg auch 1961 Max Frischs in Zürich uraufgeführtes Stück Andorra. Torberg rieb sich vor allem an Frischs Versuch, den Antisemitismus universalistisch abstrahierend nur als eine spezifische Erscheinungsform des allgemeinmenschlichen Vorurteils zu begreifen: »Hier wurzelt das fundamentale Missverständnis des Stücks. Jude, Judesein, Judentum sind keine austauschbaren Objekte beliebiger Vorurteile, wie ja auch der Antisemitismus kein beliebiges Vorurteil ist. So billig geben’s weder die Juden noch die Antisemiten.« Billig gab es auch Friedrich Torberg sein Leben lang nicht.
Das Jüdische Museum Wien widmet Fried-rich Torberg ab dem 17. September die Ausstellung »Die Gefahren der Vielseitigkeit«.
www.jmw.at